
0
Einleitung
Über die politische Wende in der ehemaligen DDR liegt mittlerweile eine Vielzahl von Büchern, Dokumentarfilmen und Zeitzeugenberichten vor. Jeder, der sich für die jüngere deutsche Geschichte interessiert, kann sich über die teilweise hochdramatischen Ereignisse vor dem Dresdener Hauptbahnhof oder in der Leipziger Innenstadt informieren. Die berührenden Bilder aus den Tagen des Mauerfalls gingen ebenfalls um die Welt.
Wie aber vollzog sich der „heiße Herbst“ des Jahres 1989, dem ein nicht minder heißes Jahr 1990 folgte, auf dem „platten Land“? Zum Beispiel im Kreis Seelow?
Um es vorwegzunehmen: Der politische Umschwung kam hier eher auf leisen Sohlen daher. Spektakuläre Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten fanden im Oderland nicht statt. Dazu waren und sind dessen Bewohner viel zu friedfertig!
Als am 07. und 08. Oktober 1989 die Menschen in Berlin und Leipzig todesmutig für eine bessere DDR demonstrierten, saßen die Einwohner von Letschin, Lebus, Golzow oder Seelow, noch abwartend vor den heimischen Fernsehgeräten. Die Bewohner des Oderbruchs stammen nun einmal von den braven Preußen ab. Und Preußen opponieren bekanntlich nicht so leicht gegen die Obrigkeit. Kein Wunder also, dass an den Tankstellen in den Süd-Bezirken der DDR, Autofahrern aus anderen Regionen, das Benzin verweigert wurde.
Wie auch immer: SED und Staatssicherheit gaben auch im Kreis Seelow ihre Bastionen auf.
Kampflos und friedlich. Dennoch keineswegs freiwillig! Menschliche Dramen blieben ebenfalls nicht aus. Schon allein deshalb lohnte es sich, diese spannendende, mittlerweile fast fünfundzwanzig Jahre zurückliegende Zeit, noch einmal Revue passieren zu lassen. Eine Zeit, deren Realitäten heutigen Generationen seltsam unwirklich erscheinen. Wie ein Bericht aus einer völlig anderen Welt. Was ja auch so falsch nicht ist. Nur das diese „völlig andere Welt“ am 03. Oktober 1990 endgültig untergegangen ist.
Deshalb, oder gerade deshalb, lohnt es sich immer wieder an das Leben in der DDR zu erinnern. Ohne Verklärung! Aber auch ohne verzerrende Horrorgeschichten! Von wem, wenn nicht von uns Zeitzeugen, sollen denn nachfolgende Generationen erfahren, wie und warum ihre Vorfahren so und nicht anders dachten oder handelten? Von wem sollen sie denn von den Irrtümern und Zwängen erfahren, denen wir ausgesetzt waren? Und von den verlorenen Idealen. Den Ängsten, Zweifeln und Hoffnungen, die gleichfalls im Zusammenhang mit den Wendeereignissen standen.
Als Angehöriger der Volkspolizei habe ich die politische Wende und den Zerfall der DDR, an relativ exponierter Stelle erlebt. Habe erlebt, wie sich regelrechte fanatische Einpeitscher, unter dem Druck der Ereignisse, von einem Tag auf den anderen, zu „Musterdemokraten“ mutierten. Und wie andere an den schweren Enttäuschungen ob des Verlustes ihres Weltbildes zerbrachen und sich lange gehegte Vorurteile und Irrtümer in Luft auflösten.
Zum besseren Verständnis der folgenden Schilderungen möchte ich den Leser auf eine Zeitreise in das Frühjahr 1989 einladen. Folgen Sie mir bitte zu einem kleinen Rundgang durch das Volkspolizeikreisamt Seelow:
Wir betreten das VPKA durch den Vordereingang. Die Tür ist offen, denn heute ist Sprechtag. Langsam geht es über die Eingangsstufen hinauf in den Flur. Rechts neben der Treppe befindet sich der Warteraum. Wer hier auf einen der rotgepolsterten Stühle, mehr oder weniger geduldig Platz nimmt, tut dieses aus den verschiedensten Gründen. Frau Witte aus Podelzig möchte ihre Cousine in der Bundesrepublik besuchen. Heute wird sie erfahren, ob die Reise genehmigt wurde. Nervös, ein zerknülltes Taschentuch in den Händen haltend, immer wieder auf ihre Armbanduhr schauend, wartet sie darauf, aufgerufen zu werden.
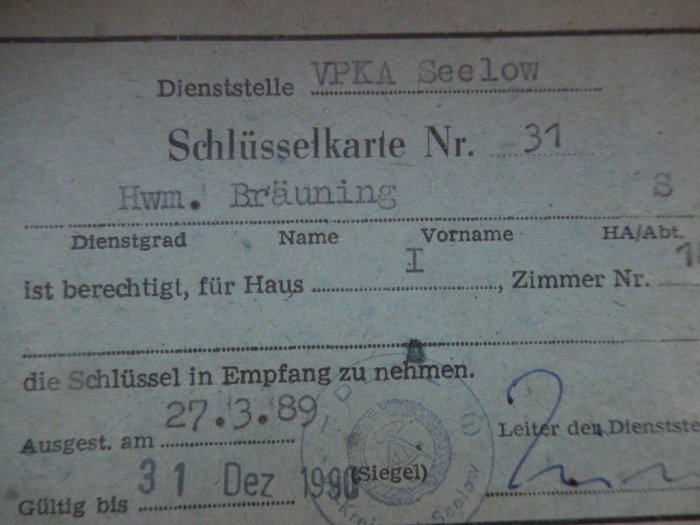
Herr Krause aus Libbenichen wirkt dagegen völlig entspannt. Er möchte lediglich den frisch erworbenen PKW, Marke „Trabant“, anmelden. Der vierzehnjährige Fred K. aus Sietzing, gilt ab heute als „vollwertiger Bürger der DDR“. Bekommt er doch in wenigen Minuten in der Meldestelle den blauen Personalausweis ausgehändigt. Dagegen hat der Trepliner Karsten Wolf allen Grund, finster drein zu schauen. Die Kriminalpolizei beschuldigt ihn eines Diebstahls. Für den er sich im Rahmen einer „Beschuldigtenvernehmung“ zu verantworten hat. Krampfhaft überlegt Wolf, wie er die Kriminalisten von seiner Unschuld überzeugen kann. Entwirft Antworten, nur um sie gleich wieder zu verwerfen.
Nun verlassen wir den nüchtern eingerichteten, alles andere als gemütlichen Warteraum wieder. In der Pförtnerloge, hinter einer halb geöffneten Glasscheibe, thront auf einem abgesessenen Bürostuhl, der so genannte Hausposten. Ein altgedienter, kurz vor der Berentung stehender Volkspolizist. Auf der braunen Platte des Schreibtisches stehen zwei Telefone. Eins dient der Kommunikation mit den einzelnen Dienstbereichen. Während das andere den Hausposten per Direktleitung mit dem „Operativen Diensthabenden“ verbindet.
Routiniert fertigt der VP-Meister den Besucherverkehr ab. Nebenbei kontrolliert er Dienstausweise eintretender Volkspolizisten, gibt Schlüssel aus oder nimmt sie entgegen und gibt eintretenden Bürgern geduldig Auskunft.
Lassen wir den Hausposten in Ruhe. Widmen wir uns lieber den einzelnen Bereichen des Volkspolizeikreisamtes! Zunächst im unteren Flur. Beginnen wir mit dem Zimmer 3. Der unter der Leitung von Leutnant der VP Petra K. stehenden Meldestelle. Es gibt wohl kaum einen Einwohner des ehemaligen Kreises Seelow, der diesen mit Schreibtischen und Karteischränken ausgefüllten Raum nicht kennt. Mehr oder weniger freundliche Damen, in den grünen Uniformen der VP, oder im weinroten Kostüm der Zivilangestellten, bearbeiten unter anderem Personalausweisangelegenheiten, stellen polizeiliche Führungszeugnisse aus nehmen Änderungen in den Melderegistern vor und nehmen Visa-Anträge bei geplanten Reisen ins sozialistische Ausland vor.

Dezember 1989
Nirgends liegen Freude und Leid, Hoffnung und bittere Enttäuschung dichter beisammen, als in den Zimmern 4 und 5. Hier werden Reiseanträge ins Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet, kurz NSW, geprüft, entgegengenommen oder sofort abgelehnt und gegebenenfalls zur weiteren Ermittlung an den zuständigen Abschnittsbevollmächtigten sowie die Kreisdienststelle für Staatssicherheit weitergeleitet. Die beiden Sachbearbeiter, ein Unterleutnant und eine VP-Obermeisterin, bemühen sich den undankbaren Job so gut wie möglich auszuüben. Letztendlich sind sie es, die den Bürgern Entscheidungen offerieren, deren Hintergründe sie selbst nicht kennen.
Wie bei Frau Witte: „Wir müssen ihnen leider mitteilen, dass ihr Antrag zu einer Besuchsreise in die BRD von den zuständigen Organen der Deutschen Republik nicht genehmigt wurde“, sagt die VP-Obermeisterin im mitfühlenden Tonfall. Fassungslos bricht Frau Witte in Tränen aus. Die Frage nach dem warum kann die VP-Obermeisterin nicht beantworten. Sie weiß nicht, dass Frau Witte ihrem Sohn die Ablehnung „verdankt“. Hatte dieser doch vor zwei Jahren bei der NVA einen Speziallehrgang als Funker belegt. Frau Wittes Sohn gilt nun als Geheimnisträger. In den Augen der Staatssicherheit wäre das Risiko zu groß, dass Frau Witte während ihres Besuches von westlichen Geheimdiensten wegen ihres Sohnes kontaktiert werden könnte. Fürsorge oder Paranoia?
Einspruch gegen diese oder ähnliche Entscheidungen kann man im Zimmer 6 erheben, bei Hauptmann Heinz H., dem Leiter der Abteilung „Pass und Meldewesen“. Doch führt der Einspruch nur selten zum Erfolg. Auch ein Heinz H. kann gegen Entscheidungen der Staatssicherheit nichts ausrichten.
Eine massive Gittertür und ein elektronisches Zahlenschloss sichern das Zimmer 7 vor unbefugten Eindringlingen. Nur wenige handverlesene Mitarbeiter dürfen dieses Zimmer, in dem, auf Karteikarten verzeichnet, die Personaldaten sämtlicher Einwohner des Kreises Seelow lagern, betreten. Und wenn, dann niemals allein. Dieser Weisung muss sich selbst Hauptmann H. unterordnen. Einzige Ausnahme: die Mitarbeiter der Kreisdienststelle für Staatssicherheit. Diese dürfen sich jederzeit, allein und ungestört, in der „Kreismeldekartei“ aufhalten.
Im Zimmer Nummer 8 hören wir lautes Schreibmaschinengeklapper. Hier ist der Arbeitsbereich der Verkehrsunfallbearbeitung. Kurz VUB. Hauptwachtmeister Bernd K. vernimmt einen Zeugen. Der ihm Auskunft über den Hergang eines schweren Verkehrsunfalls geben soll. Über einen Mangel an Arbeit braucht sich K. nicht zu beklagen. Verkehrsunfälle mit Personenschäden oder gar tödlichem Ausgang, gehören schon in der DDR zum Alltag der Seelower Polizei.
Kommen wir zum Zimmer 9. Dem Aufenthaltsraum der operativen Verkehrsüberwacher. Wir treffen niemand an. Hauptwachtmeister Burkhard M. steht auf der Seelower Hauptkreuzung. Auf einem Podest stehend, virtuos den schwarz-weißen Verkehrsstab schwingend, regelt er den Verkehr. Diesen Job wird zum Jahresende eine Ampelanlage übernehmen. Während M. den Verkehrsstrom lenkt, kümmert sich VP-Obermeister Horst Ru. in Letschin um die Aufnahme eines Verkehrsunfalls. Für diese Tätigkeit steht ihm ein speziell ausgerüsteter Barkas zur Verfügung. Funkrufname „Fasan 10/400“.
Zimmer 10 ist das Domizil von VP-Obermeisterin Ursula (Ulla) Wa.. Unterstützt von Carola D., einer Zivilangestellten, leitet sie die KfZ-Zulassungsstelle.
Der wohl bekannteste Verkehrspolizist Seelows, Unterleutnant der VP Werner Bo., fungiert im Zimmer 11 als KfZ-Hilfssachverständiger. Um Unterleutnant Werner Bo., vom Seelower Volksmund „der lange Bo.“ genannt, ranken sich zahlreiche, nicht immer nett gemeinte Legenden. Zum Beispiel die Mär, dass er selbst der eigenen Ehefrau wegen eines unbedeutenden Verkehrsverstoßes eine gebührenpflichtige Verwarnung verpasst hätte.
Denselben Unsinn erzählt man sich, in abgewandelter Form, wohl überall in der Welt über Verkehrspolizisten.
Zu den lebenden Legenden gehört zweifellos auch Hauptmann Benno Ku., Seelows oberster Verkehrspolizist. Der im Zimmer 12 seinen „Gefechtsstand“ hat. Hauptmann Ku‘s Wort hatte Gewicht im Kreis Seelow. Wehe, wenn im Winter auf den Straßen Chaos herrschte! Weil die Räumdienste ihrer Pflicht nicht rechtzeitig nachkamen. Ganz besonders böse werden konnte er jedoch, wenn eines seiner Familienmitglieder, einzig und allein wegen der Verwandtschaft mit ihm, bei einem etwaigen Gesetzesverstoß, unverdiente „mildtätige Schonung“ wiederfuhr. Die Gesetze gelten entweder für alle. Oder für keinen. So lautete Bennos konsequent den Mitarbeitern vorgelebte Devise.
Gleich neben seinem Büro, im Zimmer 13, residierte die Führerscheinstelle. Hauptwachtmeister Jörg W. und die Zivilangestellte Inge Sch. haben bereits zu dieser frühen Stunde alle Hände voll zu tun.
Am Ende des Flurs angelangt, werfen wir noch schnell einen Blick in den Innenhof. Dort befinden sich Garagen und die Waffenkammer. Das Reich von VP-Obermeister Wilfried (Willi) Sch., dem liebevoll „Pulverwilli“ genannten Waffenmeister des VPKA.
Wir gehen wieder hinein in den Flur. Zurück bis an die Pförtnerloge. Der Hausposten drückt einen unter dem Schreibtisch verborgenen Knopf. Ein Summton ertönt. Ein kurzer Druck, schon öffnet sich die Tür, welche den „Publikumsbereich“ von den sonstigen Räumlichkeiten des Volkspolizeikreisamtes trennt.
Es geht nun die Treppe hinauf in die erste Etage. Gleich links neben der Treppe treffen wir auf zwei von außen mit dickem braunem Leder gepolsterten Bürotüren. Hinter der rechten Tür, im Zimmer 19, residiert das geheimnisumwitterte „Kommissariat 1“ der Kriminalpolizei. Normale Volkspolizisten dürfen die Schwelle des Zimmers nicht übertreten. Unversehens öffnet sich die Tür. Jedoch nicht für uns. Sondern für Hauptmann Wolfgang Ka., den Verbindungsoffizier der Seelower Staatssicherheit. Einer der „K 1-er“ schüttelt ihm die Hand. Schon schließt sich die Tür wieder. Neugierige Blicke sind hier unerwünscht!
Nebenan, im Zimmer 18, geht es dagegen weit offener zu. Hier residiert die Seelower Schutzpolizei. An der rechten Wand stehen Umkleideschränke. In der Mitte des Raumes ein langer, von Stühlen umgebener Konferenztisch. An dessen Stirnseite sich ein Schreibtisch mit einem schwarzen Telefon darauf, anschließt. Dieser Platz ist dem VP-Hauptwachtmeister Ralf Tr., Gruppenführer und damit rechte Hand des „Leiters der Schutzpolizei“, vorbehalten. O VP-Obermeister Gerhard Ma. und VP-Hauptwachtmeister Gerald E., die beiden Streifenführer der Seelower Schutzpolizei, dürfen dieses Privileg, bei Abwesenheit des Gruppenführers, ebenfalls in Anspruch nehmen. Für jeden im VPKA Seelow neu eingestellten Volkspolizisten, stellte das Zimmer 18 so etwas wie die erste Station auf der mehr oder weniger langen „Karriereleiter“ dar.
Innerhalb der Schutzpolizei herrschte eine hohe Fluktuationsrate, so dass die Gesamtzahl der Schutzpolizisten, ohne „Hauswache“, im Durchschnitt nie mehr als fünf oder sechs Mitarbeiter betrug. Die Gründe für den ständigen Wechsel lagen zum einen in der „Banalität“ des Streifendienstes begründet. Anders als heute, beschränkte sich der Aufgabenbereich eines Schutzpolizisten im Wesentlichen auf kriminalpräventive und ordnungsrechtliche Maßnahmen. So war es zum Beispiel undenkbar, dass ein Streifenpolizist an Tatorten eine Strafanzeige aufnimmt, oder Ermittlungen oder Spurensuche durchführt. Was analog auf die Aufnahme von Verkehrsunfällen zutrifft. Schutzpolizisten kamen zwar vielfach bei Straftaten und Verkehrsunfällen zum Einsatz, jedoch nur, um die „Fachorgane“ zu unterstützen. Wem dieses auf die Dauer zu eintönig wurde, wechselte in den anspruchsvolleren Dienst von Verkehrs oder Kriminalpolizei. Oder übernahm als Abschnittsbevollmächtigter Verantwortung für ein bestimmtes Territorium. Von der Bevölkerung wurden die Schutzpolizisten als „Tippelbrüder“ belächelt. Wobei sich heute so mancher „den Streife laufenden Schupo“ zurückwünscht!
In das Zimmer 18 werden wir später wieder zurückkehren. Widmen wir uns zunächst den weiteren Abteilungen des Volkspolizeikreisamtes Seelow:
In unmittelbarer Nähe treffen wir auf eine weitere Polstertür. Die von außen keine Klinke besitzt. Dafür jedoch das schon bekannte elektronische Zahlenschloss. Den Code kennen freilich nur die Mitarbeiter des Stabes. Der sich hinter der besagten Polstertür verbirgt. Zusätzlich zum Zahlenschloss hängt ein mit einem grauen Metallgehäuse versehenes Telefon an der Wand. Wer den geheimen Zahlencode nicht kannte, konnte über dieses Telefon dem „Operativen Diensthabenden“ um Einlass bitten.
Wieder ertönt ein Summton. Wir betreten nun den Stab. Das „Herz und Hirn“ des VPKA. Abermals durchschreiten wir einen langen, von Büroräumen gesäumten Flur. Immer geradeaus. Nehmen Kurs auf das Lagezentrum. Dem wohl interessantesten Bereich des Volkspolizeikreisamtes. Bevor es hineingeht, verharren wir zunächst abermals vor einer verschlossenen Tür. Diesmal genügt es jedoch, wenn wir die Klingel betätigen. Nun sind wir endgültig in der „Kommandozentrale“ angelangt. Beißender Geruch schlägt uns entgegen. Überall riecht es nach Spiritus. Dieser wurde bei der Vervielfältigung von Papieren, im so genannten „Ormig-Verfahren“ benötigt. Die mit einer Klappe versehene Tür stellt kein Hindernis mehr dar. Staunend betreten wir das Reich des „Operativen Diensthabenden“, kurz „ODH“. Dem wohl wichtigsten Offizier in diesem Hause.
Schauen wir uns ein wenig um:
Die Wände des Raums sind flächendeckend mit Metallplatten verkleidet. Zur Ausstattung gehören ein Stahlschrank und verschiebbare detaillierte Landkarten. An einer Wand hängen, an Magneten befestigte Kärtchen mit den Namen der diensthabenden Kräfte. Und der Monatsdienstplan der Schutzpolizei. Davor steht eine Schreibmaschine. Darin eingespannt, der täglich zu führende Lagefilm. Grundlage für den ebenfalls täglich zu fertigenden Rapport. In dem alle polizeilich relevanten Vorkommnisse der letzten vierundzwanzig Stunden festgehalten sind.
Das Herzstück des Raumes stellt jedoch der lange, mit bunten Tasten und Knöpfen versehene „„ODH““-Tisch dar. Rund um die Uhr laufen an dieser Stelle die Fäden zusammen. Wer im Kreisgebiet die Notrufnummern 110 oder 112 wählt, landet beim „ODH“ des VPKA Seelow. Aber nicht nur Notrufe gehen an dem Tisch ein. Direktleitungen verbinden das VPKA unter anderem mit der vorgesetzten Bezirksbehörde der VP in Frankfurt (Oder), der Kreisdienststelle für Staatssicherheit und dem Diensthabenden des Wehrkreiskommandos.
Über Funk koordinierte der Offizier von diesem Platz aus Einsätze im Kreis, trifft
Anordnungen und Entscheidungen. Wichtige Betriebe und Verkaufseinrichtungen verfügen über in der Einsatzzentrale aufgeschaltete Alarmanlagen. Vierundzwanzig Stunden dauert der Dienst eines „ODH“. Ab 17:00 Uhr steht ihm ein Gehilfe, der so genannte „GODH“, zur Verfügung. In einem Nebenraum befindet sich die altmodische Telefonvermittlung, die wie ein vergessenes Requisit aus einem UFA-Film anmutet. Montag bis Freitag, von 07:00 Uhr- 16:30 Uhr, vermittelt ein Mitarbeiter der Nachrichtenabteilung jedes eingehende Gespräch, wie in alten Zeiten, per Hand. Kurz vor dem Feierabend, sorgte ein umgelegter Hebel dafür, dass die Gespräche bis zum nächsten Morgen auf den „ODH“-Tisch umgeleitet wurden.
Neben dem Telefonvermittlungsschrank stand ein hellroter Fernschreiber. Ein im Vergleich zur Vermittlung modernes, bereits mit einem maschinenlesbaren Lochstreifen versehenes Gerät.
Lassen wir den Diensthabenden in Ruhe weiterarbeiten. Im weiteren Verlauf werden wir ihn noch öfter besuchen.
Im Stabsbereich geht es zunächst zurück in den Flur der ersten Etage. Von dort geht es über die Treppe hinauf in die obere Etage. Dort haben die „Krimis“, die Kriminalpolizei, ihren Sitz. Telefone klingeln. Irgendjemand trägt Akten von einem Büro ins andere. Der Kriminaltechniker Oberleutnant Klaus Wied. schleppt den großen braunen Spurensicherungskoffer aus seinem Zimmer. Sein besonders Fachwissen ist gefragt. In Lebus wurde wieder einmal in die dortige Kaufhalle eingebrochen. Oberleutnant Klaus K. wird ihn zusammen mit Unterleutnant Jürgen Sa. dorthin begleiten. Vor Ort wird die Einsatzgruppe der K bereits vom zuständigen ABV, Leutnant der VP Wilfried Sch., erwartet. Vor den Männern liegt ein langer, arbeitsreicher Tag. Intensive Spurensuche, Rundumermittlungen in Tatortnähe und Zeugenvernehmungen. Bei einem Einbruch von solch einer Dimension steht die Kriminalpolizei von Anfang an unter erheblichen Erfolgsdruck. Straftaten wie diese, passen nicht ins offiziell vermittelte Bild der „stetig weniger werdenden Kriminalität im Sozialismus“.
Offiziell wurde die Kriminalpolizei vom Hauptmann der K Dietrich S. geleitet.
In den Augen vieler Polizisten und, ja, auch Ganoven galt jedoch der charismatische, fachlich hochversierte Oberleutnant Peter V. als der wahre Chef im Ring. Wenn es Peter V. nicht gegeben hätte, dann hätte ihn ein Krimiautor erfinden müssen. Peter schonte sich nie, wenn es um die Aufklärung einer Straftat ging. So kam es nicht nur einmal vor, dass er nachts irgendwo auf Lauer lag, sich gegen Morgen zwei Stunden Schlaf auf dem Schreibtisch seines Büros gönnte und dann am Tage ganz normal Dienst verrichtete. Zigaretten und Kaffee kompensierten den mangelnden Schlaf nur unzureichend. Auf die Dauer keine besonders glückliche, vor allem jedoch keine gesundheitsfördernde Methode. Möglicherweise legte er durch sein Engagement in jenen Jahren, bereits den Grundstein für seinen frühen Tod. Peter V. starb im Spätherbst 2002 an einem Herzinfarkt. Wenige Tage nach seinem fünfzigsten Geburtstag.
In direkter Nachbarschaft der Kriminalisten residiert die Führung des VPKA. Zum Beispiel Oberstleutnant der VP Wolfgang N.. Der erst vor kurzem aus Eisenhüttenstadt nach Seelow gekommene Leiter des VPKA. Oder der gutmütige, behäbige Politoffizier, Major Artur Bie.. Und nicht zuletzt, Hauptmann Sylvia R., die Kaderleiterin der Dienststelle.
Bevor es wieder hinuntergeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die große Tafel an der Wand. –Unsere Besten- steht dort in goldenen Lettern. Darunter eingerahmte Fotos von Volkspolizisten. Alle samt Mitarbeiter des VPKA Seelow. Einigen von ihnen werden wir auf
den kommenden Seiten noch „persönlich“ begegnen.
Wir steigen die Treppe herab. Jetzt geht es hinab in den Keller. Zu den Gewahrsamsräumen. Oder anders ausgedrückt: dem für DDR-Verhältnisse hochmodernen Zellentrakt. Zunächst gelangt man durch eine schwere Tür in den Wachraum. Schreibtisch, Telefon, zwei niedrige Dokumentenschränke und ein Radio füllen den engen Raum beinahe komplett aus. Die abgestandene Luft verursacht unwillkürlich Benommenheit und starke Kopfschmerzen. Durch die kleinen Fenster dringt kaum Sauerstoff hinein. Egal ob Wachtmeister oder Delinquent, wer sich hier für längere Zeit aufhalten muss, ist absolut nicht zu beneiden! Eine Gittertür trennt den Raum des Wachhabenden vom eigentlichen Zellentrakt. Insgesamt stehen dem VPKA drei Zellen zur Unterbringung „Zugeführter“ zur Verfügung. Wobei sich in aller Regel nicht mehr als eine Person darin befand. Heute sind es ausnahmsweise zwei „Gäste“. Berthold Fischer aus Alt Mahlisch, sitzt in Zelle 1. In der Nacht wurde er zur Ausnüchterung eingeliefert. Nachdem er im Alkoholrausch randaliert hatte. Fischer, mittlerweile wieder nüchtern, wird demnächst entlassen. Ganz anders sieht es bei Willi Krause aus Falkenhagen aus. Seine Ehefrau hat ihn wegen sexuellen Missbrauchs der gemeinsamen Tochter angezeigt. Oben bei der Kriminalpolizei bereiten Oberleutnant V. und Oberleutnant Volker Sch. bereits die Beschuldigtenvernehmung vor. Höchstwahrscheinlich wird Krause heute noch dem Kreisgericht Seelow vorgeführt werden. Zwecks Verkündung eines Haftbefehls. Anschließend bringt ihn ein grauer Gefangentransporter in die Untersuchungshaftanstalt Frankfurt (Oder).
VP-Unterwachtmeister Ga. schiebt heute Zellenaufsicht. Jede halbe Stunde wirft er durch den in die Türen eingebauten „Spion“, einen sorgsamen Blick auf die Zelleninsassen. Das Ergebnis dieser Kontrollen hat er anschließend akribisch in dem auf dem Tisch liegenden grünen Kontrollbuch nachzuweisen. Zusätzlich ist jede Zelle per Knopfdruck mit dem „Operativen Diensthabenden“ verbunden. Sobald der Zelleninsasse den über der Tür angebrachten Knopf betätigt, leuchtet im Lagezentrum eine grüne Lampe auf. So wie jetzt. Zuerst klingelt das Telefon. Ga. nimmt den Hörer ab. „Schau mal in Zelle 2, der hat irgend einen Wunsch“, teilt der „ODH“ in knappen Worten mit. Ga. nimmt sich das Schlüsselbund und öffnet die besagte Zelle. Krause bittet darum, eine Zigarette rauchen zu dürfen. Ga. nickt, verschließt jedoch die Zelle zunächst wieder. In Krauses persönlichen Sachen findet sich eine angebrochene Schachtel „F 6“. Der Unterwachtmeister entnimmt der Schachtel eine Zigarette. Und die unvermeidlichen Zündhölzer. Nicht ohne diese Entnahme und Krauses Wunsch zu protokollieren. Ordnung muss sein! Unterwachtmeister Ga. öffnet erneut die Zelle, lässt Krause auf den Flur treten, gibt ihm die Zigarette und reißt ein Zündholz an. Gierig saugt Krause den blauen Tabaksrauch an. Wartet vergeblich auf die lähmende Wirkung des Nikotins. Krause verspürt Redebedarf. Tausende Fragen quälen ihn. Von denen der Unterwachtmeister keine einzige beantwortet kann. Trotzdem hört er dem Ma. geduldig zu. Versucht ihn ein wenig abzulenken.
Lassen wir die beiden wieder allein. Froh, dem Mief entkommen zu sein, gehen wir durch den Kellergang zurück zur Treppe. Den sich ebenfalls im Keller befindlichen gemeinsamen Speisesaal von VPKA und „Rat des Kreises Seelow“, betreten wir ein anderes Mal. In einem Regal lagern beschädigte PKW-Teile. Beweisstücke bislang unaufgeklärter Kriminalfälle.
Wir gehen die Treppe hinauf, signalisieren dann dem Hausposten, dass er uns die Tür zum unteren Flur öffnet. Es geht hinaus auf den Gehweg. Haben wir jetzt alles gesehen? Nein,denn zum VPKA gehört noch ein weiteres Gebäude. Das so genannte „Objekt II“ in der Breiten Straße, dem Sitz des heutigen Polizeireviers.

Der kürzeste Weg führt über den Puschkinplatz. Als Wegweiser dient uns ein Schlauchturm. Der weithin sichtbar, alle übrigen Gebäude überragt. Bis in die frühen sechziger Jahre hinein verfügte Seelow über eine im „Objekt II“ untergebrachte Berufsfeuerwehrabteilung. Völlig verschwand die Feuerwehr jedoch nie. Nach der Auflösung der Abteilung zog Hauptmann der F Erwin He. und vier ihm unterstehende „Feuerwehrinstrukteure“ in das Gebäude ein. Die Instrukteure leiteten bei der Anleitung und Kontrolle der „Freiwilligen Feuerwehren“ im Kreis Seelow, eine ebenso wichtige wie verantwortungsvolle Arbeit. Weiterhin teilten sich die Kameradinnen und Kameraden der „Freiwilligen Feuerwehr Seelow“ die Fahrzeughalle auf dem Innenhof, mit dem Schirrmeister des VPKA.
Neben Hauptmann He.s Feuerwehrinstrukteuren trifft man im Gebäude auf die „Versorgungsdienste“. Bei der Armee würde man wohl von „Rückwärtigen Diensten“ sprechen. Zu ihnen gehören VP-Obermeister Günter Oe., der „Spieß“ des VPKA.
Oder, polizeilich korrekt ausgedrückt: Der Meister vom Innendienst, kurz MvI.
Und nicht zu vergessen: der fleißige Schirrmeister VP-Hauptwachtmeister Eberhard H.
Zu den Versorgungsdiensten gehörte ebenso Hausmeister Winfried (Winnie) Wa., der Ehemann der oben bereits erwähnten Verkehrspolizistin Ulla.
Karin O., die sich um die gesundheitlichen Belange der Angehörigen des VPKA kümmernde Krankenschwester, darf eben nicht unerwähnt bleiben. Ihr Domizil befand sich gegenüber den Dienstzimmern der Feuerwehr. Einmal in der Woche fand hier die Sprechstunde des
ansonsten im Krankenhaus arbeitenden Vertragsarztes des Volkspolizeikreisamtes statt.
Die Räumlichkeiten am Ostende des Flurs gehörten der Schutzpolizei. In dem Büro auf der rechten Seite saß Hauptmann der VP Fred Hü.. Der „E-Offizier“, wobei das E für Erlaubniswesen stand. Auf Hü.‘s Tisch landeten Anmeldungen von öffentlichen Veranstaltungen aller Art. Dem Hauptmann oblag weiterhin die Kontrolle der wenigen Waffenscheininhaber des Kreises. Und natürlich die Ausgabe oder im Falle eines Falles, die Entziehung einer derartigen Berechtigung. Durch den „E-Offizier“ konnte die Volkspolizei von Anfang durch die Erteilung von Auflagen und Bedingungen, Einfluss auf den Charakter einer geplanten Veranstaltung nehmen. Kein Discovergnügen ohne den begehrten Stempel des VPKA Seelow! Ganz nebenbei fungierte der „E-Offizier“ noch als Stellvertreter des „Leiters der Schutzpolizei“, Hauptmann der V. Helmut T., dessen Büro sich praktischerweise gleich nebenan befand.
Statten wir ihn bei dieser Gelegenheit doch einen Besuch ab:
Zuerst betreten wir einen Vorraum. In diesem steht ein aus mehreren, mit Namenschildern versehenes Regal. Jedes einzelne Fach ist einem bestimmten Abschnittsbevollmächtigten zugeordnet und dient quasi als Behältnis für dessen Dienstpost. Zumeist Ermittlungsaufträge, aber auch Auszüge aus dem täglichen Rapport und Fachzeitschriften. Hauptmann T. achtet streng darauf, dass die Regale mindestens einmal in der Woche geleert werden. Heute ist Oberleutnant Hans-Joachim Nie. zu diesem Zweck extra aus Zechin nach Seelow gekommen. In seinen Händen hält er einen Packen Papier. Die Abteilung „Pass & Meldewesen“ verlangte um Auskunft zu Antragsstellern auf eine Besuchsreise in die Bundesrepublik oder Westberlin. Oberleutnant Nie. runzelte des ungeliebten bürokratischen Aufwandes wegen, die Stirn, ehe er die Ermittlungsaufträge in die Tiefe der mitgeführten Tasche versenkte.
Hauptmann T. treffen wir hinter seinem Schreibtisch an. Vor ihm der Dienstplan der Schutzpolizei für den kommenden Monat. Über den er schon seit Stunden brütete. Daneben ein übervoller gläserner Aschenbecher. In dem eine halb ausgedrückte Kippe munter vor sich hin qualmte. T. verließ den Platz hinter dem Schreibtisch nur sehr selten. Ein Umstand, der seinem Körper nicht unbedingt gut tat. Das schrille Läuten des hellroten Telefons riss den Hauptmann aus der Planung. „Hallo, bin ich hier in der Gaststätte –Central-, in Marxwalde?“, wollte eine Frauenstimme wissen. „Ich verbinde“, knurrte T. genervt, ehe er den Hörer auf die Gabel legte. In beinahe vierzig Prozent aller auf den Dienstapparaten des Volkspolizeikreisamtes Seelow eingehender Anrufe, handelte es sich um Fehlverbindungen. Nirgends wurde stärker unter dem maroden Telefonnetz gelitten, als bei der Polizei.
Die knapp sechzigjährige VP-Meisterin Johanna K. betritt das Zimmer. Sie ist die so genannte „Geschäftsstellenleiterin“ der Schutzpolizei. Oder bescheidener ausgedrückt: T.s Sekretärin. Johanna K.s Geschäftsstelle befindet sich in einem von T.s Büro aus zu betretenden Nebenraum. Ihrer mütterlichen Art wegen ist die Frau vor allem bei den jüngeren Schutzpolizisten sehr beliebt. Frau K. serviert dem „S-Leiter“, so lautet die hochoffizielle Abkürzung seiner Funktion, einen Kaffee. T. bedankt sich. Er kommt jedoch nicht dazu, dass heiße Getränk zu genießen. Hauptmann Manfred B., der Leiter des „ABV-Gruppenposten Süd“, will unbedingt ein größeres Problem mit dem S-Leiter klären. Wie oben bereits angedeutet, unterstanden die Abschnittsbevollmächtigten, neben den Schutzpolizisten und der Hauswache, ebenfalls dem S-Leiter. Im Kreis Seelow untergliederten sich die jeweiligen Bereiche der Abschnittsbevollmächtigten (ABV) , die Gruppenposten „Nord“ und „Süd“. Während der im Manschnower Weidenweg ansässige „Gruppenposten Süd“ unter dem Kommando von Hauptmann Manfred B. stand, wurde das „nördliche Gegenstück“, dessen Räumlichkeiten sich in einer Baracke in der Selower Straße der Jugend befanden, von Oberleutnant Norbert W. befehligt. Und über allen stand, oder besser gesagt saß, Hauptmann Helmut T.
Soweit der angenommene Rückblick in die „Vorwendezeit“. Um etwaigen Verklärungsvorwürfen vorzubeugen: auch in einer Diktatur verlief das Leben in gewisser Hinsicht in völlig normalen Bahnen. Die sich von den heute bekannten und gewohnten, gar nicht so sehr unterscheiden. Dass der „piefige gemütliche Eindruck“ jedoch nur eine von vielen Facetten des DDR-Lebens darstellt, soll dieser Blog zeigen
a) Januar-April 1989
Silvesternacht im VPKA Seelow
Blick in den ehemaligen Stabs und ODH-Bereich des VPKA Seelow, April 1993
Dem gerade erst wenige Momente jungem Jahr 1989 konnte man in der Silvesternacht noch nicht ansehen, dass es einmal als eines der wichtigsten in die deutschen Geschichtsbücher eingehen würde.
Ich verbrachte den Jahreswechsel in der Einsatzzentrale des Volkspolizeikreisamtes Seelow. Gemeinsam mit dem „Operativen Diensthabenden, Hauptmann Manfred St., VP-Meister Paul Schn., der in dieser Silvesternacht als Gehilfe des Diensthabenden fungierte und meinem Streifenpartner, VP-Obermeister Gerhard Ma. Punkt Mitternacht stießen wir mit frisch gebrühten Rondo-Kaffee auf die kommenden dreihundertfünfundsechzig Tage an. Im selben Moment verwandelten unzählige Feuerwerksraketen den grauen wolkenverhangenen Nachthimmel über der kleinen Kreisstadt im äußersten Osten der DDR in ein bunt schillerndes Inferno. Sekundenlang tauchte das von Raketen hell erleuchtete Rathaus aus der Dunkelheit auf. Um dann wie unwirkliche Geistererscheinung sofort wieder darin zu versinken. Immer wieder liefen Gruppen von Feiernden am Gebäude des VPKA vorbei. Irgendjemand warf einen Blitzknaller vor die Eingangstür, der anschließend unter lautem, von den Wänden der umstehenden Häuser widerhallendem Getöse explodierte. Dem Knall schloss sich nicht minder lautes Gegröle und Gelächter an. Nichts Besonderes in einer Nacht wie dieser, in der fast überall ausgelassen gefeiert wird. Und der Alkohol in Strömen floss.
Gerhard hatte vorsorglich den grün-weißen Lada, der uns als Funkstreifenwagen diente, auf dem sicheren Innenhof der Dienststelle abgestellt. Ein unter den Wagen geworfener Feuerwerkskörper konnte durchaus erheblichen Schaden anrichten. Für mich war es nicht die erste Silvesternacht, das ich im Dienst verbrachte. Seit sechs Jahren trug ich nun eine Uniform. Zuerst die der Grenztruppen der DDR ,bis ich unmittelbar nach dem Ende meines Grundwehrdienstes zur Volkspolizei wechselte. Mittlerweile hatte ich mich daran gewöhnt, Dienst zu schieben, wenn andere feiern. Wer das nicht kann, hat in der Polizei nichts zu suchen!
VP-Meister Schn. telefonierte mit seiner Frau, seiner „Dicken“, wie er sie stets zärtlich nannte. Der stets gut gelaunte Endfünfziger agierte normalerweise als persönlicher Fahrer von Oberstleutnant N.. Dem Leiter des VPKA Seelow. Paul, der jahrelang als Verkehrspolizist über die holprigen Straßen des Kreises streifte, liebte seinen Fahrerjob. Obwohl, oder weil ihm kaum jemand darum beneidete. Cheffahrer zu sein bedeutet: dem „Alten“ rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Und stundenlanges einsames Warten im Auto, während der Genosse Oberstleutnant irgendwo an einer endlosen Beratung teilnahm.
Paul nahm das ganze mit Humor. Wie überhaupt Humor zu seiner Lebensmaxime gehörte.
„Warum gibt eigentlich in der DDR keine Erdbeben?“, fragte Paul und blickte dabei verschmitzt in die Ruhe. „Ganz einfach, immer wenn der liebe Gott die Erde wackeln lassen möchte, dabei aber von oben auf die DDR herabschaut und unsere Straßen sieht, dann sagt er: „Weiter Kinder, hier war ich schon.“
Vor Begeisterung schlug sich Paul auf die Schenkel, während sich die anderen ein verhaltenes Lachen abringen. Wusste doch jeder, dass es sich um keinen Witz im eigentlichen Sinne handelte. Sondern um eine treffende Zustandsbeschreibung. In der DDR lag so einiges im Argen. Und nicht nur das Straßennetz!
Trotzdem, dass sich unser Staat in den kommenden Monaten quasi von selbst auflösen würde, ahnte in dieser Nacht niemand. Ich wohl am allerwenigsten. Zunächst zog ich in Gedanken, ganz für mich allein, ein Resümee des vergangenen Jahres. Dreihundertfünfundsechzig Tage zuvor gehörte ich noch dem „Wachkommando Missionsschutz“ in Berlin an. Meiner ersten Station innerhalb der „Deutschen Volkspolizei“.
Dort erfuhr ich zum ersten Mal am eigenen Leibe, wie schwer sich, von Werbern zusätzlich forcierte, illusorische Vorstellungen, mit der Realität vereinbaren lassen. Als sich der suggerierte „hochinteressante, abwechslungsreiche Dienst“, plötzlich als öder stundenlanger Wachdienst vor Botschaften oder Residenzen entpuppte.
Wie sehr ich die lichten Weiten des Oderbruchs liebte und für mein seelisches Gleichgewicht benötigte, wurde mir beim Anblick der vor seelenlosen Betonklötzen nur so strotzenden Neubausiedlung Berlin-Marzahn erst so richtig bewusst. Wäre es nach dem Willen meiner damaligen Vorgesetzten gegangen, hätte ich dort eine Wohnung bekommen. Angeblich ein Privileg. Auf das ich jedoch gern verzichten konnte.
Gedankenversunken kaue ich auf dem Kuchen herum. Fast zwei Jahre dauerte der Kampf, um mich aus den Fängen des „Wachkommandos Missionsschutz“ zu lösen. Dem Versetzungsgesuch zum heimatlichen VPKA Seelow folgten endlose Aussprachen. Zunächst mit den unmittelbaren Vorgesetzten. Als diese nicht fruchteten, schaltete sich der Politoffizier der „Wache Pankow“, in der ich nach einem kurzen Praktikum in Berlin-Mitte Dienst verrichtete, ein.
Ich nahm es hin, als uneinsichtiger „Egoist“ und Verräter bezeichnet zu werden. Schließlich erwies sich ein Wechsel an der Spitze unserer Wachabteilung als absoluter Glücksfall für mich. Ende 1986 übernahm der väterliche Hauptmann Bo. das Zepter von dem ehrgeizigen Leutnant Sch.
Bo. schlug mir einen Kompromiss vor:
„Drei Jahre Mindestdienstzeit sind Pflicht bei uns. Wenn diese drei Jahre vorbei sind, dann darfst du nach Seelow.“ Ein Kompromiss mit dem ich leben konnte. Am 01. Juni 1988 waren diese drei Jahre vorbei. Endlich konnte ich meinen Dienst bei der Seelower Schutzpolizei antreten. Vor allem: endlich konnte ich mich als richtiger Volkspolizist fühlten. Wurden doch die Posten des Missionsschutzes von den Kollegen in den Revieren und Inspektionen in Berlin, nie richtig akzeptiert, wenn nicht sogar belächelt und als „Eckensteher“ verspottet. Darüber konnte mich selbst die dem Missionsschutz gewährte, vergleichsweise bessere Bezahlung nicht hinwegbringen.
Die Versetzung nach Seelow war jedoch bei weitem nicht das einzige einschneidende Ereignis des Jahres 1988. Am 23.04. führte ich meine damalige Verlobte zum Seelower Standesamt. Kennengelernt hatten wir uns elf Monate zuvor, an der Gedenkstätte. Kannten wir uns denn überhaupt? Während sie weiterhin zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn in Libbenichen lebte, diente ich weiterhin im Missionsschutz. Sehen konnten wir uns lediglich an jedem zweiten Wochenende. Die Heirat gehörte zu den vielen Schnellschüssen meines Lebens. Ob damit bereits die Grundlage für das spätere Scheitern dieser Ehe gelegt wurde, mag ich jedoch nicht zu beurteilen.
Der Streifendienst im VPKA gestaltete sich, im Vergleich zum Missionsschutz, tatsächlich spannend und abwechslungsreich. Es mag verrückt klingen, aber ich freute mich auf jeden Dienst.
Im Oktober desselben Jahres schlug mir Oberstleutnant N. eine Laufbahn als Abschnittsbevollmächtigter (ABV) vor. Begeistert willigte ich sofort ein. Wie in der DDR üblich, waren die folgenden Jahre meines noch jungen Lebens bereits völlig verplant. Im September 1989 würde ein Vorbereitungsseminar in Potsdam beginnen. In mehrmals stattfindenden Wochenlehrgängen, im Abstand von zwei oder drei Monaten, sollte ich dann mein fachliches Können und körperliche Fitness unter Beweis stellen. Bei erfolgreicher Absolvierung schloss sich dem ein einjähriges Direktstudium an der „ABV-Schule“ in Pretzsch (damals DDR-Bezirk Halle) an. Und dann, als Lohn für die Mühe, die Ernennung zum Leutnant der VP. In Gedanken sah ich mich bereits als stolzen Offizier durch die Gegend laufen. Illusionen über Illusionen, die nach und nach erneut wie Seifenblasen zerplatzen sollten.
Ungeachtet dessen, stand die erste Veränderung des neuen Jahres für mich und meine kleine Familie bereits unmittelbar bevor. In drei Tagen würden wir die ungemütliche Altbauwohnung in der Libbenichener Lindenstraße gegen eine moderne Neubauwohnung im fünfzehn Kilometer entfernten Manschnow tauschen.
Die Wohnung stammt aus dem Kontingent der NVA und war eigentlich für die Bediensteten des „Fort Gorgast“ gedacht. Bekommen hatten wir sie nur auf Vermittlung des VPKA. Weil sich meine Frau beim Leiter der Schutzpolizei über die ungesunden Wohnverhältnisse in Libbenichen beklagte. Dabei wollte sie überhaupt nicht weg, aus ihrem Heimatort. Egal, den Plänen des VPKA zufolge, werden wir spätestens 1992 wieder umziehen müssen. Und zwar nach Gusow. Weil ich dann den in Rente gehenden Hauptmann Berthold Boi., „beerben“ werde. Soweit jedenfalls die Theorie.
Ein urplötzlich eingehender Notruf riss mich aus den rosaroten Zukunftsräumen. Hauptmann Stenger stellte die halbvolle Kaffeetasse ab, nahm den Hörer in die Hand und drückte auf einer der vielen Tasten.
„Volkspolizeinotruf“, meldete er sich der Vorschrift entsprechend.
„Kommunistenschweine, eure Zeit läuft ab“, lallte eine tiefe männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Dann legte er sofort wieder auf. Da der Anruf aus irgendeiner Telefonzelle kam, würde der Anrufer kaum identifiziert werden können. Normalerweise nichts, was wert wäre, nach knapp einem viertel Jahrhundert noch erwähnt zu werden. Wenn sich nicht wenige Monate darauf dieser unfreundliche Anruf als geradezu prophetische Weissagung herausgestellt hätte.
Kreiskommandostabsübung

Mittlerweile war es März geworden. Inzwischen hatten wir uns in Manschnow eingelebt. Außer uns wohnten noch zwei Polizistenfamilien in dem Haus. Die des Gruppenpostenleiters Oberleutnant W. und die von Oberleutnant der K, Klaus Wied., der als einziger über einen Telefonanschluss im Haus verfügte. Ein Umstand der sich noch mehrfach bezahlt machen sollte. Wir wohnten im oberen Geschoss. Die Familie direkt unter uns, fiel in mehrfacher
Hinsicht aus dem Rahmen. Nicht nur, weil niemand von ihnen bei der Volkspolizei arbeitete. Beinahe an jedem Abend begann sich das Ehepaar zu streiten. Nicht selten dermaßen laut, dass wir keinen Fernseher mehr benötigten. Der treibende Keil bei den lautstarken verbalen Auseinandersetzungen schien jedes Mal die Frau zu sein. Die am Tage beim „Rat des Kreises Seelow“ einer Bürotätigkeit nachging, während er sich als Tischler über Wasser hielt.
Hinter vorgehaltener Hand erfuhr ich, dass es bei ihm um einen ehemaligen NVA-Berufssoldaten handelte, der, zusammen mit anderen, im großen Stil Gerätschaften aus dem Bezirksnachrichtenlager der NVA in Reitwein entwendet und weiterverkauft hatte. Irgendwann flog die Angelegenheit auf, der damalige Oberfähnrich wurde aus der NVA entlassen, vor Gericht gestellt und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Jahre später erzählte mir ein ehemaliger Angehöriger des Wehrkreiskommandos Seelow, dass in diesem Fall mehrere hochrangige, jedoch nicht zur Verantwortung gezogene Offiziere verwickelt waren. Der Oberfähnrich traf allein die „ volle Härte der Gesetze“. Wem wundert es, dass er später, zutiefst verbittert, in den Alkohol abrutschte.
Mitte März stand eine Kreiskommandoübung auf dem Plan. Die im Kreis Seelow dislozierten bewaffneten Organe, sprich VP, MfS, NVA und die Betriebskampfgruppen, probten den angenommenen Ernstfall. Wie üblich, bemühten sich die Verantwortlichen in den Stäben, dass vorher niemand etwas von der angesetzten Großübung erfuhr. Wie üblich sickerte der Termin der Übung, auf die Uhrzeit genau, bereits eine Woche vorher durch. Wer an diesem Tag frei hatte, sah zu, dass er sich nicht Zuhause aufhielt. Ich konnte mich dem Brimborium nicht entziehen. Auf meinem Dienstplan stand eine Tagschicht in der Hauswache. Immerhin konnte ich mich rechtzeitig darauf vorbereiten, dass diese Schicht nicht, wie üblich, um 16:30 Uhr enden würde. Irgendwie hoffte man ja immer noch, dass die Übung ausfällt. Das sich das ganze am Ende als wildes Gerücht herausstellte. Hätte denn die Verkehrspolizei sonst, ausgerechnet an solch einem Tag, eine große Verkehrskontrolle angesetzt? An der sämtliche verfügbaren VP-Helfer teilnahmen.
Egal, an jenem Tag, einem Freitag, saß ich also in der Hauswache. Bis um 12:00 Uhr herrschte normaler Publikumsverkehr. Dem meine völlige Aufmerksamkeit galt. Zunächst deutete nichts darauf hin, dass in den kommenden Stunden etwas Außergewöhnliches passieren könnte. Auf die angebliche Übung konnte ich ohnehin dankend verzichten, waren doch solche „Spielchen“ erfahrungsgemäß mit einer tüchtigen Portion unnötigem Stress verbunden.
Endlich hatten die letzten Bürger das VPKA verlassen. In den Dienstzimmern vom „Pass & Meldewesen“ und der Verkehrspolizei bereitete man sich auf das kommende Wochenende vor. 12:30 Uhr! Noch eine halbe Stunde. Wenn bis dahin nichts geschieht, dann hat sich der Alarm endgültig als Latrinenparole erwiesen, hoffte ich inständig.
Hauptmann T. erscheint an der Pförtnerloge. Ich drücke den Knopf der automatischen Türöffnung. Der S-Leiter gefällt sich in diffusen Andeutungen und geht anschließend die Treppe hinauf zum Stab. Verdammt, wie ich diese Geheimniskrämerei Ha., ärgere ich mich im Stillen.
12:45 Uhr treffen die ersten VP-Helfer ein. Ich melde ihr Eintreffen telefonisch dem „ODH“.
„Lass sie im Warteraum Platz nehmen“, beschied der Offizier knapp. Normalerweise werden die Helfer sofort von einem Volkspolizisten in Empfang genommen. Zum Kaffeeplausch im Aufenthaltsraum der Verkehrspolizei. Irritiert nahmen die VP-Helfer, alle samt gestandene, im Rentenalter stehende Männer, im Warteraum Platz.
Punkt 13:00 Uhr klingelte das „„ODH“-Telefon“ in der Hauswache:
„Soeben wurde Einsatzalarm für das gesamte VPKA Seelow ausgelöst! Sorgen Sie dafür, dass alle Zivilisten sofort das Haus verlassen!“ „Was ist mit den VP-Helfern?“ „Habe ich mich nicht klar und deutlich ausgedrückt? Wenn ich alle Zivilisten sage, dann meine ich auch alle Zivilisten!“
Die Frage hätte ich mir eigentlich sparen können. VP-Helfer galten nun einmal im „Ernstfall“ als ganz gewöhnliche Zivilisten. Voll Bedauern verkündete ich den Senioren, den Ausfall der Verkehrskontrolle. „Warum das denn? Ihr könnt euren Scheiß langsam alleine machen“, maulte ein grauhaariger im gesamten Kreis als Fahrprüfer bekannter Mittsechziger.
„Wir haben Alarm. Da kann man nichts machen“, versuchte ich den enttäuschten VP-Helfer zu besänftigen.
Anschließend verschloss ich die Eingangstür und meldete dem Diensthabenden Vollzug.
Ich erhielt Befehl, meine Einsatzuniform anzulegen. Ab nach oben ins „Zimmer 18“.
Hektisch wechselte ich die normale Dienstuniform gegen die Einsatz und Ausbildungsuniform . Diese bestand aus einer grünen Stiefelhose, Hemd, Binder, Uniformjacke, Käppi, dem braunen Lederkoppel nebst Pistolentasche und schwarzen Knobelbechern. Stahlhelm und Gasmaskentasche komplettierten den „kriegerischen“ Aufzug.
Anschließend ging es wieder hinunter. Dermaßen martialisch kostümiert, harrte ich der Dinge die da kommen. Allmählich schlug die anfängliche zähe Ruhe in die bei solchen Anlässen übliche Hektik um. Fluchend hetzten Offiziere die Treppen hinauf. Oder herunter. Mitarbeiter verlangten fluchend Einlass. Man hatte sie telefonisch alarmiert und aus dem bereits sicher geglaubten Dienstfrei zurückgeholt. Stoisch schloss ich die eben erst verschlossene
Eingangstür wieder auf.
Irgendwann wurde ich aus der Hauswache herausgelöst und zum „Objekt II“, geschickt, wo der „S-Leiter“ wie ein Feldherr in seinem Dienstzimmer hockte und bereits auf mich wartete. Mit mir saßen noch vier weitere Schutzpolizisten im Raum. Unsere Aufgaben für die kommenden Stunden lautete: „Vor dem geöffneten Eingangstor des Objektes Posten zu beziehen.“ Keine angenehme Aufgabe. Seit Stunden fiel feiner Regen vom Himmel. Und das bei Temperaturen um fünf Grad Celsius. Die Ablösung erfolgte im Zwei-Stunden-Takt. Trotz aller Widrigkeiten erschien uns die gestellte Aufgabe weit angenehmer, als die Aussicht, irgendwo im Dreck herumzukriechen. Was durchaus zu den möglichen Optionen zählte. Ist doch bekanntlich der Phantasie von Schreibtischstrategen keinerlei Grenze gesetzt.
Von 16:00 Uhr-18:00 Uhr stand ich wie ein Zinnsoldat vor dem weitgeöffneten Stahlblechtor. Hin und wieder rollten Lastkraftwagen mit aufgesessenen Kampfgruppeneinheiten auf den Hof. Offenbar erhielten die Kommandeure hier ihre Befehle. Blauer Tabaksrauch wehte von der Ladefläche. Einige erzählten laute Witze. Andere lachten. Wie auf einem Betriebsausflug.
Staatlich organisierter Männerulk, Made in GDR.

Halb misstrauisch, halb belustigt, verfolgten die in der Breiten Straße vorbeigehenden Passanten das makabre Schauspiel. Von Südwesten her, wehte der Abendwind das Geräusch knatternder MPI-Salven heran. An der notwendigen Geräuschkulisse fehlte es also ebenfalls nicht. Ein etwa fünfzigjähriger grauhaariger Mann schaute in die Richtung aus der die Schüsse kamen, blickte seine neben ihm herlaufende Frau vielsagend an und klatschte sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Unmissverständlicher kann man seine Meinung wohl kaum ausdrücken. Nachdem er mich mit einem abschätzigen Blick bedacht hatte, entfernte er sich in Richtung des Busbahnhofes. Verdammt, ich fühlte mich wie auf dem Präsentierteller. Auf großes Verständnis oder gar Begeisterung seitens der Bevölkerung, konnten wir wirklich nicht hoffen.
Derweilen verteilte der emsige Hauptmann T. Aufgaben an die im Kreisgebiet verteilten Abschnittsbevollmächtigten. Jeder von ihnen hatte einen bestimmten Punkt zu besetzen und nach „eingesickerten Diversanten“ Ausschau zu halten. Was für den erfahrenen Dorfsheriff nichts anderes als das berühmte „Verpissen im Gelände“ bedeutete. Der Großteil der Übung spielte sich ohnehin in den jeweiligen Einsatzstäben ab. Wie in dem zum „Gefechtsstand“ umfunktionierten Einsatzzentrale des VPKA Seelow. Zusätzlich zum normalen Tagesgeschehen, dirigierten konzentriert wirkende Offiziere, vor ausgebreiteten Landkarten, irgendwelche imaginären Einheiten. Die einem Gott sei Dank ebenfalls lediglich imaginären Gegner, dem Garaus machen sollten.
Gegen 18:00 Uhr übernahm VP-Oberwachtmeister Tr. den Posten vor dem Tor.
Ich durfte in der Kantine zum Abendessen. Zur Stärkung der Einsatzkräfte hatten die Küchenfrauen einen riesigen Berg Hackepeterbrötchen bereitgestellt.
Dazu gab es kräftig gewürzte, aromatisch duftende Soljanka. So lässt sich der Krieg aushalten!
Im Verlauf des Abends verschlug es mich auch einmal zum „ODH“. Ich sollte irgendein Fernschreiben für Hauptmann T. in Empfang nehmen.
Die Lagezentrale glich einem Bienenkorb. Oberstleutnant N. hielt dort die Fäden in der Hand. Ständig klingelten irgendwelche Telefone. Ein Polizist markierte an einer Lagekarte die Stellungen imaginärer „Truppen“, andere riefen sich Meldungen und Befehle zu. Sehr zum Leidwesen des Operativen Diensthabenden, dem die ungewohnte Hektik sichtlich auf die Nerven ging. Störte das Chaos doch den eigentlichen Dienstbereich, der trotz allem weiter gehen musste.
Erst weit nach Mitternacht endete die Übung. Stolz verkündete Oberstleutnant N. dem Genossen Rainer Pa., dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Seelow, den erfolgreichen Abschluss:
„Im engen Zusammenwirken aller Schutz und Sicherheitsorgane, konnten die eingesickerten Diversanten aufgespürt und vernichtet werden. Genosse 1. Sekretär, im Kreis Seelow hat der Gegner auch weiterhin keine Chance!“
Nirgends sonst war die DDR so perfekt wie im Vernichten von erfundenen Gegnern.
Der Feuerteufel von Wulkow
Im April 1989 hielt eine Brandserie in Wulkow bei Trebnitz die Seelower Polizei in Atem. Kurz hintereinander gerieten stets gegen Mitternacht eine Strohmiete und eine Scheune der LPG Marxwalde in Brand. Sowohl im VPKA Seelow als auch in der Kreisdienststelle für Staatssicherheit läuteten die Alarmglocken. Hatte man es „nur“ mit einem Pyromanen zu tun? Oder steckte gar „Feindtätigkeit“ dahinter? Wie überall in der DDR, wurde auch im Kreis Seelow hinter jedem größeren Schadensereignis der „BBKF“, für nicht Eingeweihte: der Bitterböse Klassenfeind, vermutet. Ganz besonders im Jubiläumsjahr der Republik. Das dem „Westen“ angeblich ganz besonders schwer im Magen lag.
Sofort nahmen die Kriminalisten des VPKA unter der Leitung von Oberleutnant Peter V. die Ermittlungen auf. Angesichts der Brisanz und des enormen Sachschadens entschied Oberst der K H., der Kripochef des Bezirkes Frankfurt (Oder), den Einsatz der „Branduntersuchungskommission“. Diese stand unter der Leitung von Major Gerald Bu. und setzte sich aus Experten von Kriminalpolizei und Feuerwehr zusammen.
Brandermittlungen gehören zu den schwierigsten Disziplinen der Polizei. Akribisch wühlten sich in blaue Arbeitskombis gehüllte Kriminaltechniker durch halb verbrannten, vom Löschwasser durchnässten Schutt. Einen technischen Defekt oder eine Selbstentzündung, konnten die Ermittler von Anfang an ausschließen. Ebenso spielte die Option eines finsteren gedungenen Agenten, der von Hass auf den Sozialismus durchdrungen LPG-Scheunen in Brand setzte, für die eher nüchternen Kriminalpolizisten lediglich eine untergeordnete Rolle.
Die bisherigen Erfahrungen besagten, dass höchstwahrscheinliche völlig andere Motive hinter den Bränden standen. Etwa ein aus Geltungsdrang handelndes, „chronisch unterfordertes“ Mitglied der örtlichen Feuerwehr. Möglicherweise litt der Täter ja unter einer Psychose? Egal welches Motiv dahintersteckte, eines schien schon jetzt so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche: es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis der große Unbekannte erneut Feuer legt. Falls ihm die Kriminalpolizei bis dahin nicht das Handwerk legt!
Schon früh geriet Bernd H., ein junger, in der LPG als Schlosser arbeitender Familienvater aus Wulkow, in den Fokus der Ermittler. H., der zu den regelmäßigen Besuchern der Dorfgaststätte gehörte, hatte diese jeweils kurz vor dem Ausbruch der Brände, erheblich betrunken verlassen. Außerdem führte sein Heimweg direkt an den späteren Brandorten vorbei. Bereits bei der ersten Vernehmung legte der Schlosser, mit den Indizien konfrontiert, ein Geständnis ab.
Als Tatmotiv gab er an, bedingt durch den zuvor genossenen Alkohol, „einen inneren Zwang verspürt zu haben.“ Richtig erklären konnte sich der im Ort angesehene, als fleißig bekannte H. die Taten allerdings nicht. Genauer gesagt: ihm fehlte jegliche Erinnerung an die entscheidenden Minuten.
H. wurde noch in Arbeitskleidung festgenommen und einstweilen in eine der Gewahrsamszellen des VPKA Seelow verbracht.
Derweil bemühten sich die Kriminaltechniker weiter, beweiskräftige Spuren zu sichern. Bislang jedoch vergeblich! Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt!
Major Bu. ordnete zunächst einen Lokaltermin ab. Zusammen mit dem Beschuldigten wollte man dessen Heimweg von der Gaststätte bis in die heimische Wohnung, rekonstruieren.
Dabei wurde mir der Aufgabe zuteil, den „Delinquenten“ während der Maßnahme zu bewachen. Mein Herz klopfte vor Freude. Ich durfte die Profis der „BUK“ unterstützen. Solche Ehre wurde einem nicht jeden Tag zuteil.
Ehrfürchtig und stolz zugleich, stieg ich in den saharagelben Einsatzwagen, Typ Warburg 353, der Frankfurter Branduntersuchungskommission. Bernd H. nahm zwischen mir und einem Kriminalisten, auf der Rückbank Platz. Zur Verhinderung einer eventuellen Flucht, hatte man ihm Handschellen angelegt.
Heimlich begann ich meinen „Schützling“ zu mustern. Wirklich gefährlich sah er keineswegs aus. Ungefähr eins Achtzig groß und schlank. Die offenen Gesichtszüge wirkten durchaus vertrauenserweckend. Einen Brandstifter hatte ich mir jedenfalls anders vorgestellt. Den Kopf tief auf die Brust gesenkt, vermied er, wohl aus Scham, jeglichen Blickkontakt.
Wir näherten uns über Diedersdorf, Jahnsfelde und Trebnitz, dem Einsatzort an. Kurz vor dem Ortseingang von Wulkow wich der Fahrer einem entgegen kommendem Traktor aus. Von seinem erhöhten Sitzplatz konnte der Traktorist direkt in das zivile Polizeifahrzeug hineinschauen. Krampfhaft versuchte H. sein Gesicht in den vor dem Körper gefesselten Händen zu verbergen. Sicherlich kannte er den Traktoristen.
Überall in Wulkow standen kleine Menschengruppen herum, die den Wagen der Kriminalpolizei von weitem bei der Ankunft beobachteten. Wir hielten direkt vor dem Eingang der Gaststätte. Flankiert von Polizistenkörpern, stieg der vermeintliche Brandstifter aus. Verlegen bat er darum, die Handschellen abzudecken. Bu. nickte und legte eine Jacke über die dicke graue „Schließacht“.
Wahrscheinlich wünschte sich der LPG-Bauer in diesem Moment nichts sehnlicheres, als Zuhause im heimischen Bett aufzuwachen. Und festzustellen, dass er das ganze lediglich geträumt hat. Aber für ihn gab es kein Erwachen.
Vor dem Beginn der Maßnahme, wurde H. von der Kriminalpolizei unmissverständlich darüber belehrt, dass bei einem Fluchtversuch die Schusswaffe angewendet wird. In diesem Moment wich der letzte Rest von Farbe aus dem abgespannten, traurigen Gesicht des Gefangenen. Uns aus meinem ebenfalls. Wenn jemand hätte schießen müssen, dann doch wohl ich! Wer weiß schon, was sich im Kopf eines Menschen in Ausnahmesituationen wie dieser abspielt. Der Gedanke an Flucht, mag er bei klarer Überlegung noch so abwegig erscheinen, erscheint da nicht selten als letzter Ausweg.
Zu meiner großen Erleichterung zeigte sich „ mein Schützling“ absolut kooperativ. Er dachte nicht einmal an eine, ohnehin aussichtslose Flucht.
Nach wenigen hundert Metern, stoppten wir an der Stelle, wo sich vor einer Woche noch eine mit Stroh gefüllte Scheune befand. Von der nichts als halbverkohlte Trümmer übrig geblieben war. Mühsam versuchte er die entscheidenden, im tiefen Alkoholnebel versunkenen Momente ins Bewusstsein zurückzuholen.
In diesem Moment trat ein älterer, hagerer Mann auf uns zu. Der Vater von H., wie sich bald herausstellen sollte. Stumm sahen sich die Männer an. Dicke Tränen liefen ihnen dabei über die Wangen. „Warum?“, schluchzte der Vater mit zitternder Stimme. Hilflos weinend zuckte der Sohn mit den Schultern. In Situationen wie diesen fällt es schwer, „nur Polizist“ zu sein.
Major Bu. wartete einen Moment. Dann legte er dem Vater sanft die Hand auf die rechte Schulter und sagte: „Ich habe vollstes Verständnis für ihren Kummer. Aber wir müssen hier weiter unsere Arbeit machen. Alles Weitere wird sich klären.“
Der Vater schluchzte noch einmal, ehe er sich aufs Fahrrad schwang. Hilflos, noch immer wie in Kind schluchzend, schaute ihm sein Sohn hinterher.
Gegen Mittag fuhren wir zurück nach Seelow. Die Brandserie von Wulkow schien nun endgültig aufgeklärt zu sein. Jetzt fehlte nur noch die abschließende Vernehmung des Beschuldigten. Anschließend würde er dann dem Haftrichter im Kreisgericht Seelow vorgeführt werden. Niemand zweifelte ernsthaft daran, dass dem Haftbefehl nicht stattgegeben wird. Zu eindeutig erschien die Beweislage!
Am nächsten Tag erschien in der Bezirkszeitung „Neuer Tag“ ein ausführlicher Bericht über den Ermittlungserfolg der Volkspolizei. Ohne Wenn und Aber: der LPG-Bauer galt sowohl in den Augen der Polizei als auch der Öffentlichkeit als überführt. Die Vorführung vor dem Haftrichter des Kreisgerichtes Seelow, erschien lediglich als notwendige Formsache. Selbst der größte Skeptiker zweifelte nicht, dass der Richter am Ende gegen den Wulkower Haftbefehl erließ.
Zur nicht geringen Überraschung aller Anwesenden widerrief der LPG-Bauer vor dem Haftrichter, sein Geständnis. Er bestritt zwar nicht, an den späteren Brandorten vorbei gelaufen zu sein. Ihm fehlte jedoch, Alkohol bedingt, jegliche Erinnerung an die konkrete Tatzeit.
Eine reine Schutzbehauptung? Solange keine weiteren Beweise für die Täterschaft vorlagen, sah sich der Haftrichter gezwungen, dem Haftbefehl nicht statt zugeben. Trotz akribischer Suche war es den Kriminaltechnikern nicht gelungen, auswertbare Spuren zu sichern. Was das Feuer nicht zerstörte, wurde vom Löschwasser hinweggespült.
Riesengroße Enttäuschung breitete sich unter den Kriminalisten, die sich um die Früchte ihrer Arbeit betrogen sahen, aus. Doch so leicht wollten sich die Männer um Major Bu. nicht geschlagen geben. Man brachte den LPG-Bauern wieder zurück in den Gewahrsam. Dessen Gefühlschaos, hin und her gerissen zwischen Hoffen und Bangen, kann man wohl kaum erahnen.
Als ich gegen 17:00 Uhr meinen Nachtdienst antreten wollte, befand sich H. noch immer in der Zelle. Statt auf Streife zu gehen, stand für mich zu allererst Zellenaufsicht auf dem Plan. Der Operative Diensthabende unterrichtete mich in knappen Worten über den Stand der Dinge. Zunächst wollte ich meinen Ohren nicht trauen! Einigkeit bestand darin, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Kreisstaatsanwalt wollte sich noch einmal mit dem Richter in Verbindung setzen. Um diesen zu überzeugen, den Haftbefehl doch noch zu erlassen. Binnen einer einzigen Stunde, drohte der spektakuläre Ermittlungserfolg in eine beispiellose Blamage um zuschlagen.
Links neben dem Eingang zur Pförtnerloge führten ausgelatschte Treppenstufen nach unten. In den Kellergang. An dessen Ende sich der Gewahrsamtrakt befand. Ich klopfte gegen eine schwere, metallene Tür. Unterwachtmeister Achim West öffnete mir. Achim sah bleich und müde aus. Eine Auswirkung der sauerstoffarmen, von einem ekelhaften Gemisch aus Tabakrauch und menschlichen Ausdünstungen geschwängerten Luft. Der Aufenthalt im Zellentrakt gestaltete sich zur Qual, sowohl für die Insassen als auch für den jeweiligen Wachhabenden. Es wurde streng darauf geachtet, dass die Zellenaufsicht den Bereich nicht ohne Erlaubnis verließ. Nicht ohne Grund: zwei Jahre zuvor hatte sich ein überführter Kinderschänder an der Heizung mit einer Schnur erdrosselt. Während der diensthabende Wachtmeister in der Konsum-Kaufhalle nach Bananen anstand.
Immerhin wurde der Zellentrakt nach dem Vorkommnis modernisiert. Fortan verfügten die Zellen über eine, mit dem Operativen Diensthabenden verbundene optische Signalanlage. Weiterhin verlangte die Vorschrift, dass der Wachhabende in zwanzigminütigem Abstand eine Sichtkontrolle durchführte, deren Ergebnis in einem grünen Aufzeichnungsbuch akribisch nachgewiesen werden musste.
Bei der Übergabe nahm ich H., der unruhig in der engen Zelle auf und ab lief, in Augenschein. Als er mich sah, huschte ihm ein kaum merkliches Lächeln übers Gesicht.
„Können Sie bitte nachfragen, wie lange ich hier noch auf eine Entscheidung warten muss?“, bat er mich geradezu flehentlich. „Ich kümmere mich darum“, versprach ich ihm. Natürlich bekam ich auf meine diesbezügliche Anfrage lediglich die Antwort, „ dass ich mich gefälligst zu gedulden hätte.
Eine Gittertür trennte den Zellengang vom Aufenthaltsraum des Wachhabenden. Ich schloss zunächst die Gittertür auf und dann die Tür von H.‘s Zelle.
„Bitte, darf ich eine rauchen?“ Bernd H. flatterte am ganzen Körper. Die hohe nervliche Anspannung forderte ihren Tribut. In den kommenden Minuten oder gar Stunden, würde sich sein weiteres Schicksal entscheiden. Zur Auswahl standen die Einweisung in die Untersuchungshaftanstalt Frankfurt (Oder), oder die Entlassung. Über seinen ramponierten Ruf in der Gemeinde machte er sich, begreiflicherweise, noch keine Gedanken.
Ich holte ihm die gewünschten Zigaretten und ließ ihn auf dem Flur Platz nehmen. „Tuen Sie mir bitte den Gefallen und lassen mich hier draußen warten.“ In Absprache mit dem „ODH“, der sich sofort einverstanden erklärte, durfte H. die Zeit bis zur Entscheidung vor der Zelle verbringen. Eine Zigarette nach der anderen rauchend, immer wieder umherlaufend, sah er der für ihn wahrlich schicksalhaften Entscheidung entgegen. Dabei schaute er mich immer wieder hilfesuchend an. Dabei konnte ich ihm wohl am wenigsten helfen.
Endlich klingelte das Telefon. Hoffnungsvoll nahm ich den Hörer ab. Fehlanzeige! H.warf mir einen fragenden Blick zu. Der „ODH“ wollte nur wissen, ob es Vorkommnisse gab. Ich schüttelte kurz den Kopf. H. sank enttäuscht zusammen, steckt sich eine Zigarette mit dem glühenden Stummel der anderen, halb aufgerauchten an. Unruhig wie ein Tiger im Käfig schlurft er den Zellentrakt auf und ab.
Allmählich artete das Ganze in Psychoterror aus, dachte ich wütend.
Als dann endlich, nach beinahe zwei Stunden, die erlösende Nachricht eintraf, hätte ich am liebsten laut losgejubelt. Wieder sah mich H. in einem unbeschreiblichen Mix aus Angst und Hoffnung an. „Ab nach Hause“, rief ich ihm lächelnd zu, worauf er erleichtert die Hände über
den Kopf zusammenschlug.
Am Ende blieb die Frage nach dem Täter bis heute offen. War Bernd H. tatsächlich unschuldig? Wir werden es wohl nie erfahren!
Mai-August
Die letzte Maidemonstration

In der DDR galt der 1. Mai im offiziellen Sprachgebrauch als Kampf und Feiertag der Arbeiterklasse. Ganz so überspitzt hat es die „Arbeiterklasse“ jedoch nie gesehen. Zwar gehörte die vormittägliche, traditionelle Maidemonstration fast überall dazu, den Rest des Tages verbrachte man jedoch einträchtig mit der Familie oder Freunden auf den dazugehörigen Volksfesten. Logischerweise floss an einem Feiertag wie diesem der Alkohol in Strömen. Was für die Volkspolizei regelmäßig ein Mehr an Arbeit bedeutete. Die VP hatte jedoch nicht nur mit den unangenehmen Begleiterscheinungen der Feierlichkeiten zu kämpfen. In der chronisch paranoiden DDR fürchtete man sich vor allem vor etwaigen Störungen der Maidemonstration. „Feinde“ könnten sich unter die marschierenden Arbeiter mischen, um ihre „sozialismusfeindlichen Parolen“ an den Ma. zu bringen. Die Geschehnisse während der traditionellen Luxemburg/Liebknecht-Ehrung im Januar 1988, hatten bei SED und „Sicherheit“ ein Republikweites Trauma“ verursacht.
Selbst „Terroranschläge“ rückten in den Bereich des Möglichen:
Am 1. Mai 1989 herrschte in den VP-Dienststellen des Oderbezirkes „erhöhte Alarmbereitschaft“. Als ich gegen 06:00 Uhr früh, gemeinsam VP-Hauptwachtmeister Norbert So. zum Dienst erschien, überraschte uns der „Operative Diensthabende“, Hauptmann Gerhard Schm., mit der Mitteilung, dass man in der vergangenen Nacht unter der Ehrentribüne in Frankfurt (Oder) einen Brandsatz gefunden hatte. Angeblich war der Brandsatz derart präpariert, dass er genau zum Zeitpunkt der Demonstration gezündet hätte.
Seltsamerweise fand der mysteriöse „Anschlag“ später keinerlei Erwähnung mehr.
Norbert und ich erhielten den Auftrag, die Seelower Ehrentribüne, bis zum Beginn der Demonstration stündlich nach verdächtigen Gegenständen abzusuchen.
Derweilen meldeten sich nach und nach weitere Polizisten zum Dienst. Verkehrsregulierer, die beiden für die Stadt zuständigen Abschnittsbevollmächtigen inklusive einer Vielzahl
„Freiwilliger Helfer der Volkspolizei“. Draußen im Kreisgebiet lag die polizeiliche Absicherung des Tages in den bewährten Händen der Abschnittsbevollmächtigten. Selbstverständlich unter oberster Federführung des Volkspolizeikreisamtes. Hauptmann Schm. schwitzte bereits jetzt Blut und Wasser.
Der Puschkinplatz Mitte der sechziger Jahre
Gegen 06:30 Uhr traten Norbert und ich die Fußstreife an. Wie gefordert, führte der erste Gang zur am Tag zuvor auf dem Puschkinplatz errichteten hölzernen, mit rotem Stoff
ausgekleideten Ehrentribüne. „01. Mai 1989-Vorwärts mit guten Taten zum 40. Geburtstag der Republik“, stand in goldenen Lettern über der Tribüne zu lesen.
Akribisch suchten wir jeden Zentimeter, auf und unter der Tribüne ab. Wie erwartet, ohne die geringste Beanstandung. Norbert malte sich lachend den Anblick trampelnder und hüpfender Funktionäre, denen urplötzlich der Boden unter den Füßen zu heiß wurde, aus. So richtig ernst konnten wir das ganze schon damals nicht nehmen. Wer in aller Welt sollte denn solch ein Risiko auf sich nehmen und ausgerechnet unter der von „tausend Augen“ bewachten Ehrentribüne in Frankfurt (Oder) Brandsätze deponieren?
Aufmerksam schweifte mein Blick über den zurzeit menschenleeren Puschkinplatz. Von der Apotheke, vorbei an Taxistand und der seltsamen Hirtenplastik, vorbei an der seit April 1945 turmlosen Kirche, dem quadratischen Cafe, der HO-Gaststätte „Oderbruch“ bis zur Hauptkreuzung. Auf der gerade ein einsamer weißer Trabbi vorbeiknatterte. Weit und breit keine Spur von irgendwelchen „feindlichen Aktivitäten“.
Überall in der Stadt, an Laternen und Hauswänden, klebten Plakate: –7. Mai Wahltag Der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Unsere Stimme den Kandidaten der Nationalen Front-, versehen mit dem Konterfei eines entschlossen dreinschauenden jungen Arbeiters.
In Anbetracht der Tatsache das es zu den umworbenen Kandidaten der Nationalen Front ohnehin keine Alternative gab, ein geradezu aberwitziger Werbeaufwand.
Selbstverständlich durften auch die üblichen, mit den Emblemen von DDR und SED versehenen „1-Mai-Plakate“ nicht fehlen. An einem Tag wie diesen, gehörten die Dinger einfach dazu. Nicht auszudenken jedoch, wenn sich in der Nacht irgendjemand an den Plakaten zu schaffen gemacht hätte! Ein abgerissenes oder beschmiertes Wahlplakat wäre einem Super-GAU gleichgekommen. Aber auch in dieser Hinsicht war auf die braven Seelower Verlass.
Mitten auf dem großen, an diesem Tag für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrten Parkplatz, wo sich heute ein Büro und Geschäftshaus erhebt, standen Imbissbuden und Zelte. Männer, braune, abgeschabte Lederschürzen vor den Bäuchen, schleppten metallene Bierfässer heran. Andere trugen Kisten voller Fleisch und Würste. Wir gingen hinüber zum festlich geschmückten Rathaus. Dann weiter zum Bauernmarkt. Wo gegen Mittag ein Blasmusikkonzert stattfinden soll. Fleißige Helfer kümmerten sich um die Sitzplätze. Verantwortliche verteilten letzte Anweisungen. Alles ging den gewohnten sozialistischen Gang. Zumindest scheinbar!
Die Stunden bis zum Beginn der Demonstration vergingen ohne Vorkommnisse. Zur Feier des Tages hatte Petrus den Blauesten Himmel spendiert, den man sich für den Start in den Wonnemonat Mai nur wünschen konnte. Goldene Sonnenstrahlen tauchten die Szenerie in gleißendes Licht und sorgten schon am Vormittag für angenehme Temperaturen.
Allmählich pilgerten immer mehr, sommerlich gekleidete Seelower Familien, in die Innenstadt. Wer nicht an der Demonstration teilnahm, gruppierte sich in der Nähe der Buden. Derweilen erteilte der „ODH“ im VPKA in der Mittelstraße noch einmal Instruktionen an die Einsatzkräfte. Hauptmann Schm., genannt „Varianten-Schm.“, fühlte sich dabei sichtlich in seinem Element. Bis auf meine Wenigkeit besaßen die anderen Polizisten langjährige Erfahrungen in punkto Maidemonstration. Die im Prinzip stets nach demselben Schema abliefen: Zunächst sammelten sich die Teilnehmer vor dem „Kreisbetrieb für Landtechnik“, in
der Breiten Straße. Angeführt von einem Streifenwagen der Verkehrspolizei, würde sich der aus Vertretern der städtischen Betriebe und Einrichtungen, uniformierten Kampfgruppenmitgliedern, Traktoren, Pionieren und blaubehemdeten FDJ-Mitgliedern zusammengesetzte Zug, pünktlich um 11:00 Uhr am „Kreisbetrieb für Landtechnik“ in Bewegung setzte. An der Marschstrecke platzierte Lautsprecher beschallten Teilnehmer, Zuschauer und Sicherheitskräfte mit schmissigen Arbeiterliedern. Ernst Busch schmetterte
„Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht.“
Von der Breiten Straße, dem Ausgangspunkt, ging es dann auf die Frankfurter Straße, vorbei an der Ehrentribüne zur Hauptkreuzung, dort nach links auf die Clara-Zetkin-Straße und dann wieder zurück in die Breite Straße.
Während der Demonstration sorgten die zahlreichen Posten dafür, dass nicht etwa ein Auto irrtümlicherweise auf die Strecke geriet. Oder dass jemand auf die Straße lief. Für die meisten der Volkspolizisten und VP-Helfer ein Routinejob. Ich erlebte dagegen zum ersten Mal während meiner Dienstzeit einen derartigen Umzug. Dass es gleichzeitig auch der letzte sein wird, konnte ich nicht ahnen. Seitens der Einsatzleitung wurde mir ein Platz auf dem Gehweg, zwischen dem Parkplatz und der vorbeiführenden Frankfurter Straße, direkt gegenüber der Ehrentribüne zugewiesen.
Hinter meinem Rücken versammelten sich immer mehr Zuschauer. Darunter viele Kinder. Während links von mir, bis hin zum Eingang der Sparkasse, an der Einmündung zur Mittelstraße, mehrere Mitarbeiter der hiesigen Kreisdienststelle für Staatssicherheit Aufstellung nahmen. Von denen jeder einzelne eine Mai-Nelke aus rotem Plastik in den Händen hielt. „Hast du gesehen, da stehen die Typen von Horch und Guck“, flüsterte jemand hinter mir seinem Nebenmann zu. Laut genug, dass es im Umkreis von einem Meter jeder hören konnte. In einer Kleinstadt wie Seelow kannte die „Geheimen“ ohnehin jedes Kind.
In einer Mischung aus Ehrfurcht und Neugier schaute ich zur Ehrentribüne.
Auf der mittlerweile die „führenden Genossen“ des Kreises Seelow, ihre Positionen eingenommen hatten. Unter ihnen, in Ordenbehangen und in Paradeuniform, die Chefs von VP, Wehrkreiskommando, MfS, Zivilverteidigung. Nicht zu vergessen, die Kommandeure der in Falkenhagen und Kietz stationierten sowjetischen Garnisonen. Sowie Rainer Pa., der 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Seelow. Ferner Christian Re., seines Zeichens Vorsitzender des „Rates des Kreises Seelow“. Ein buntes, aus verschiedenfarbigen eleganten Anzügen und Uniformen bestehendes, beiderseits von einem Fahnenmeer flankiertes Sammelsurium. Direkt vor der Tribüne, saßen in langer Reihe, auf gepolsterten Stühlen, die so genannten Arbeiterveteranen. Aktivisten der „ersten Stunde“. Keiner jünger als siebzig. An den Straßenrändern nahmen Schulklassen, papierne DDR-Fahnen in den Händen haltend, Aufstellung.
Währenddessen wurde es immer wärmer. Endlich ertönte im Lautsprecher meines Funkgerätes der ersehnte Funkspruch:
„Fasan 10 / 355, Demonstrationszug hat sich soeben in Bewegung gesetzt“.
Mir rannte der Schweiß in wahren Sturzbächen den Rücken herunter. Jetzt bloß keinen Fehler machen, schoss es mir unentwegt durch den Kopf. Misstrauisch drehte ich mich nach den Zuschauern um. Meine Sorge erwies sich jedoch als völlig unbegründet. Diszipliniert wie eh und je verharrten die Seelower hinter der Absperrkette des Gehweges. Kurze Zeit später erreichte die Spitze des Demonstrationszuges meinen Standplatz. Eine Lautsprecheranlage beschallte die Umgebung mit Arbeiterkampfliedern. Die Demonstrationsteilnehmer winkten „denen da oben“ zu. Und „die da oben“ winkten begeistert zurück. Wer genau hinschaute, dem blieb der seltsam distanzierte Ausdruck in etlichen Gesichtern nicht verborgen. Einige Teilnehmer lachten, während andere starr in eine Richtung blickten. So als ob sie sich für die Teilnahme schämten.

Den Eindruck einer organisierten Pflichtveranstaltung, konnten selbst die auf mitgeführten Plakaten zu lesenden Mailosungen nichts ändern. Diese standen in diesem Jahr ganz im Zeichen der anstehenden Kommunalwahl.
Und des vierzigsten Republikgeburtstages:
„40 Jahre DDR, alles mit dem Volk, alles durch das Volk, alles für das Volk“, „Mit erfüllten Plänen zur Wahl am 07.Mai“, „ Genossenschaftsbauern und Arbeiter der sozialistischen Landwirtschaft! Macht das 40.Jahr der DDR zum Jahr der höchsten Erträge und Leistungen auf den Feldern und Städten der DDR“.
Fast zum Schluss des Vorbeimarsches, ereignete sich ein auf dem ersten Blick unbedeutender Vorfall: Den Abschluss des Marschbandes bildeten Mitarbeiter der örtlichen LPG. Und deren Fahrzeuge. Darunter ein laut knatternder Traktor. Dessen Motor jeden Moment stehen zu bleiben drohte. Dicke schwarze Abgaswolken hüllten die Zuschauer am Straßenrand ein.
Dem Vehikel folgten gelangweilt erscheinende LPG-Bauern. Einige von ihnen versteckten demonstrativ die Hände tief in den Taschen der blauen Arbeitshosen. Ein anderer strapazierte unübersehbar die Kaumuskeln. Direkt vor der Ehrentribüne, unter den Augen der „führenden Genossen“, wäre der Traktor beinahe tatsächlich stehengeblieben. Im letzten Augenblick gelang es dem Fahrer, das Gefährt wieder in Bewegung zu setzen. Dunkle, übelriechende Wolken vernebelten die Ehrentribüne, während die „hohen Genossen“, wie üblich, den peinlichen Vorfall tapfer ignorierten.
Unter den Zuschauern breitete sich unverhohlenes Gelächter aus. „Da könnt ihr mal sehen, mit was für Schrott wir tagtäglich arbeiten müssen“, rief jemand aus dem Schutz der Masse heraus. Weitere Unmutsbekundungen ließen nicht lange auf sich warten: „Plunderwirtschaft“, schrie ein anderer Unbekannter in Richtung Ehrentribüne. Verlegen senkten die Stasi-Mitarbeiter die Köpfe, nur die Führung tat, als wäre nichts geschehen.
Die Qual(en) mit der Wahl

Die kommenden Tage standen völlig unter dem Eindruck der unmittelbar bevorstehenden Kommunalwahlen. In Mitten der ohnehin angespannten Lage sorgte eine Meldung aus dem zum Kreis Strausberg gehörenden, zwanzig Kilometer westlich vor den Toren Seelows gelegenen Städtchens Müncheberg für zusätzliche Aufregung. Dort hatten unbekannte Täter, quer über die mitten durch den Ort führende Karl-Marx-Straße –40 Jahre DDR und der Wahnsinn geht weiter“ geschrieben.
Die Nerven des lokalen Staatsapparates lagen blank. Nacht für Nacht kontrollierten
Volkspolizisten und „Freiwillige Helfer“ in unregelmäßigen Abständen die Wahllokale in den Orten des Kreises Seelow. Wobei die Hauptlast der Verantwortung auf den Schultern der Abschnittsbevollmächtigten lastete. Einige von ihnen, zum Beispiel der ABV von Marxwalde, schliefen sogar im Wahllokal. Jeder einzelne Volkspolizist sehnte den Termin der Wahlen herbei. Kaum jemand, dem die paranoide Stimmung nicht auf die Nerven ging.
Jede Äußerung wurde auf die berühmte Goldwaage gelegt. In Golzow äußerte jemand, „am Sonntag bei den Wahlen Dampf ablassen zu wollen“. Sofort rasselten bei VP und MfS die Alarmglocken.
Nur ein Beispiel unter vielen. An dieser Stelle könnte jemand, der nicht in der DDR gelebt hat, die nahe liegende Frage stellen, wovor man damals eigentlich solche Angst hatte? Diese Frage kann man eigentlich kurz und knapp beantworten: Vor der Wahrheit! Schließlich wussten doch alle, angefangen vom hohen Funktionär bis zum „Schippenarbeiter“, dass die Wahlen keine Wahlen waren. Eine Wahl ohne Auswahl ist nun mal keine Wahl. Nicht umsonst nannte der Volksmund die Prozedur, „Organisiertes Zettelfalten“. Wem wundert es da noch, dass das aus heutiger Sicht völlig utopische Ergebnis schon von vorn herein feststand.
Das ganze diente lediglich einem einzigen Zweck: der Weltöffentlichkeit die feste Verbundenheit zwischen der Bevölkerung der DDR und ihrer Regierung zu suggerieren.
Eine Verbundenheit, die, so wie dargestellt, in der Realität nicht existierte. Trotzdem oder wohl besser gesagt, deshalb, musste der „schöne Schein“ erhalten bleiben. Koste es, was es wolle. Zu diesem Zweck bediente man sich der verschiedensten Mittel. Zum Beispiel des selbst für erfahrene DDR-Bürger nur sehr schwer zu durchschauenden Wahlsystems. Um mit Nein zu stimmen, musste der Wähler sämtliche auf dem Wahlzettel aufgelisteten Kandidaten „per Federstrich liquidieren“. Blieb auch nur ein einziger Kandidat verschont, galt das Ganze, trotz der offenkundigen Ablehnung, als Ja-Stimme. Wer erst gar nicht zur Wahl erschien, lag den „Oberen“ besonders im Magen. Und durfte sich deren Aufmerksamkeit erfreuen. Schließlich erwartete die SED-Kreisleitung von den Bürgermeistern, dass diese für eine hundertprozentige Wahlteilnahme sorgten.
Wenn jemand partout nicht wählen gehen wollte, meist um seine Unzufriedenheit mit dem Staat im Allgemeinen oder bestimmten Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen, bekam der Ortsbürgermeister „die Prügel“. Weil er und nicht etwa die allmächtige SED „durch politisch unkluges Verhalten die Ursache für die Unzufriedenheit gesetzt hat“. Punkt, aus Basta! Den Bürgermeistern blieb also nichts anderes übrig, als am Wahlabend in Begleitung der Wahlhelfer „Hausbesuche“ durchzuführen. So manches clevere Schlitzohr konnte dem verzweifelten Bürgermeister einige Zugeständnisse abringen. Wehe dem, wenn der Bürgermeister nicht Wort hielt. Wider besseres Wissen abgegebene Versprechen konnten sich rasch zum Selbstläufer entwickeln. Denn nach der Wahl ist vor der Wahl! Ein zweites Mal würde der Bürgermeister den Unzufriedenen nicht mehr so leicht rumkriegen.
Dem Dienstplan sei Dank, dass ich zunächst von den ganzen Wahlvorbereitungswirren verschont blieb. Erst am Freitag, den 05. Mai, trat ich gegen 17:00 Uhr zur Nachtschicht an.
Zuvor hatte ich mich in der Stadt- und Kreisbibliothek Seelow, mit allerlei Büchern versorgt. Zu jener Zeit befand sich die Bibliothek noch in einer mit blauen Blechplatten verkleideten
Baracke. Unmittelbar hinter dem Kreiskulturhaus. In direkter Nachbarschaft der Lokalredaktion des „Neuen Tag“.
Nachtschichten von Freitag auf den Samstag verliefen selten ruhig. Für einen Blick in eines der Bücher würde sich kaum Zeit finden. Ich verstaute den Beutel mit den Büchern in meinem Schrank und dann ging es auch schon zur Einweisung beim „Operativen Diensthabenden“. Hauptwachtmeister So., der gemeinsam mit mir zum Nachtdienst eingeteilt war, begleitete mich.
Wie schon vier Tage zuvor, am 01. Mai, wurden wir auch heute wieder von Hauptmann Schm. empfangen:
„Ich mache es kurz: ihr braucht heute keine Einweisung“, sagte er zur Begrüßung. „Genosse So., Sie gehen sofort in den Polizeigewahrsam und lösen dort den Genossen Müller ab. Die Kriminalpolizei hat in Libbenichen jemanden wegen sexuellen Missbrauchs vorläufig festgenommen. Zurzeit laufen noch die Vernehmungen. Ich denke mal, dass der Unhold demnächst dem Haftrichter vorgeführt wird.“ Norbert verzog das Gesicht, als ob er gerade in eine Zitrone gebissen hätte. Anschließend wandte sich Schm. an mich: „Genosse Bräuning, für Sie habe ich einen Spezialauftrag. Nach dem Waffenempfang erfahren Sie näheres.“
Ein Spezialauftrag ist immer gut! Neugierig geworden, steckte ich die „Makarov“ ins Holster und sah dabei den Hauptmann erwartungsvoll an. Schm. kramte ein Schlüsselbund hervor. „Folgen Sie mir, Genosse Bräuning“. Und der Genosse Bräuning folgte dem Genossen Schm..
Vom Stabsbereich hinunter in die Hauswache. Dort nahm Hauptmann Schm. das Honecker-Bild von der Wand. Hinter dem Bild verbarg sich eine verschlossene, mir bis dahin nicht bekannte Durchgangstür zum „ Rat des Kreises“.
Wir gingen durch diese „Geheimtür“ hindurch, einem langen Flur entlang, bis zum Pförtner der Kreisverwaltung.
„Ich möchte bitte den Schlüssel zum Versammlungsraum“, sagte der Hauptmann.
Der Pförtner, ein grauhaariger kurz vor dem Rentenalter stehender Mann, händigte den Schlüssel aus. Ordnungsgemäß quittierte der Hauptmann den Empfang.
Ich grübelte noch immer, was für ein Spezialauftrag mich in dem beinahe menschenleeren Gebäude der Kreisverwaltung erwarten würde? Der Versammlungsraum befand sich in der 2. Etage. Auf dem ersten Blick konnte ich nichts Besonderes entdecken:
Lange Tische, dazwischen eine große Anzahl gepolsterter Stühle. Gleich neben der Tür stand ein Telefon. In dem für DDR-Behörden typischem Design.
Hauptmann Schm., der den ganzen Weg über kein Wort zu mir gesagt hatte, ließ nun endlich die Katze aus dem Sack:
„Genosse Bräuning, hier in diesem Zimmer sind die Wahlunterlagen des Kreises Seelow untergebracht. Sie sind heute Nacht für die Sicherheit dieser Unterlagen verantwortlich!“
Was bin ich? In Gedanken rekapitulierte ich das gehörte noch einmal. Soll ich etwa, allein in
diesem öden Raum, auf einen Haufen Papier aufpassen?
Dem Hauptmann blieb meine „Begeisterung“ nicht verborgen:
„Nehmen Sie diesen Auftrag bitte äußerst ernst“, ermahnte er mich mit erhobenem Zeigefinger. „Morgen früh um 07:00 Uhr werden Sie durch den Genossen Seidel abgelöst. Bis dahin, lassen Sie die Unterlagen keinen Moment aus den Augen. Ich gehe jetzt wieder zurück ins VPKA. Sobald ich den Raum verlasse, schließen Sie sofort ab. Falls Sie auf die Toilette müssen, rufen Sie vorher an. Ich schicke ihnen dann jemanden, der ihren Posten übernimmt. Haben Sie mich verstanden?“
Verstanden im Sinn von gehört hatte ich das ganze sehr wohl. Verstanden im Sinne von begriffen jedoch nicht. Hauptmann Schm. setzte noch einen drauf. In dem er mir „eventuelle nächtliche Kontrolle seitens der Bezirksbehörde der Volkspolizei und der Staatssicherheit“ ankündigte.
Zum Schluss versprach mir der Offizier noch, für Verpflegung zu sorgen. Dann verließ er den endlich den Raum. Leise fluchend sank ich auf die Sitzfläche eines Stuhls.
Vierzehn Stunden können nämlich verdammt lang werden, wenn man nichts zu tun hat.
Die Wahlunterlagen befanden sich, nach Gemeinden sortiert, in mehreren separaten Bündeln, in der äußersten rechten Ecke, auf Stühlen und einem Tisch verteilt. In einem verschlossenen Behördenzimmer. Wobei sich die Frage, warum in aller Welt irgendjemand wertloses Papier stehlen sollte, geradezu aufdrängte. Glaubte man allen Ernstes, dass in diesem Moment ein Sonderkommando des „Bundesnachrichtendienstes“ in Richtung Seelow in Bewegung setzte, um in den Besitz der Unterlagen für eine Kommunalwahl zu gelangen? Offenbar schon! Anders konnte ich mir den ganzen Unfug nicht erklären.
Ganz tief in seinem Inneren zweifelte Hauptmann Schm. den Sinn der Maßnahmen ganz sicher ebenfalls an. Der Offizier fürchtete jedoch weniger obskure „Kommandounternehmen,“ als die Kontrolloffiziere der BdVP Frankfurt (Oder). Nicht auszudenken, wenn mich einer von ihnen im Falle einer unangemeldeten Kontrolle nicht auf meinem Posten antreffen würde! Als Vorgesetzter trug er nun einmal die Verantwortung.
Für mich kam es jetzt darauf an, meinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber wie?
Von dem einzigen Fenster schaute ich direkt auf die Rückwand der Kreissparkasse. Kein besonders schöner Anblick! Auf einem Schrank entdeckte ich ein Fernsehgerät. Das, zu meiner Enttäuschung, jedoch keinen Antennenanschluss besaß.
Wie gut hätte ich jetzt die aus der Bibliothek entliehenen Bücher gebrauchen können. Leider befanden sich diese, unerreichbar weit, im VPKA. Den Gedanken, den Hausposten als „Bücherboten“ einzusetzen, verwarf ich sofort wieder.
Zunächst wanderte ich in dem einige Quadratmeter großen Raum ziellos hin und her. Um dann, neugieriger Weise, einen Blick in die Wahlunterlagen zu werfen. Sagen wir es mal so: es gibt bessere und interessante Literatur, um sich einen langen Abend zu verschönern.
Gegen 19:30 Uhr servierte mir der Hausposten, ein in Ehren ergrauter VP-Meister das Abendessen.
Nach dem Essen verlegte ich mich auf das Zählen der Stühle. Irgendwann begann ich den
Raum per Schrittfolge auszumessen. Ich bekam eine Ahnung, wie sich ein Gefangener in seiner Zelle fühlt. Allmählich wurde es dunkel. Die Abenddämmerung zauberte bizarre Schatten auf der Tapete. Jede zweite Stunde musste ich Hauptmann Schm. „Lagemeldung“ erstatten. Eines tat ich jedoch nicht: den Hausposten wegen eines Toilettengangs anzufordern. Das erschien mir dann doch, salopp gesagt, zu dämlich. Zumal die Toilette gleich nebenan war.
Für mich gab es in dieser Situation nur einen schwachen Trost: die so genannten Eisheiligen hatten das schöne, noch am Maifeiertag vorherrschende Wetter völlig verdrängt. Bei Temperaturen von kaum mehr als zwölf Grad, wehte ein kalter böiger Nordostwind durchs Oderbruch.
Vom Puschkinplatz her drang das laute Gegröle eines Betrunkenen durch die Nacht. Hoffentlich kommt jetzt niemand auf die Idee nach der Polizei zu rufen. Wir haben schließlich wichtigeres zu tun. Zum Beispiel Papier bewachen, übte ich mich in Sarkasmus.
Irgendwann geht auch die längte Nacht vorüber. Müde und übernächtigt übergab ich am nächsten Morgen, um 07:00 Uhr, die „wertvollen Papiere“ an meine Ablösung. Die, offenbar vorgewarnt, einen dicken Wälzer mit sich führte. Nebst Kaffee und Wasserkocher. Derart ausgerüstet, konnte man es selbst auf diesem „verlorenen Posten“ aushalten.
Ich verabschiedete mich ins Wochenende. Froh, dem paranoiden Wahlrummel endlich entkommen zu sein. Wenn ich Montag früh wieder zum Dienst erschien, würde die Kommunalwahl 1989 endlich Geschichte sein. So glaubte ich jedenfalls.
Montag früh stand ich im VPKA um 07:00 Uhr auf der Matte. Endlich hatte mich der Alltag wieder! Am Abend zuvor hatte der als oberster Wahlleiter fungierende Egon Krenz in der „Aktuellen Kamera“ das vorläufige Wahlergebnis verkündet: satte 98 % Ja-Stimmen. Zu besonderen Vorkommnissen ist es im Kreis Seelow am Wahltag nicht gekommen. Aus der Bezirksstadt Frankfurt (Oder) wurde vermeldet, dass in einigen Wahllokalen die Stimmenauszählung von Bürgern beobachtet wurde. Eine Meldung die bei den Verantwortlichen allenfalls für Verwunderung sorgte. Aber noch keine Besorgnis erregte.
Wer hätte schon geglaubt, dass es bei dieser Wahl, die ja eigentlich keine war, Fälle von Wahlbetrug gegeben hat? Ob es solche Fälle auch im Kreis Seelow gab, entzieht sich meiner Kenntnis.
Meine Hoffnung auf einen ganz normalen Streifendienst, sollte sich an dem Montag nach der Wahl, jedenfalls nicht erfüllen. Erneut wartete ein „Spezialauftrag“ auf mich. Diesmal ging es um den Abtransport der Wahlunterlagen vom „Rat des Kreises Seelow“, zum „Rat des Bezirkes Frankfurt (Oder)“.
Der Transport erfolgte mit einem Mannschaftstransporter, Typ W 50, des VPKA.
Die Unterlagen wurden auf der Ladefläche gestapelt. Gemeinsam mit einem weiteren Schutzpolizisten sowie jemanden von der Verkehrspolizei, wurde ich zur Sicherung des Transporters bestimmt.
Bewaffnet mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole, hatten wir mit dem Streifenwagen der Verkehrspolizei den Lastwagen zu folgen.
Zuvor wurden wir von Hauptmann T. in die „verantwortungsvolle Aufgabe“ eingewiesen:
„Ihr dürft unterwegs auf keinen Fall anhalten“, mahnte der Schutzpolizeichef eindringlich. „Egal was ihr seht. Selbst wenn es sich um einen schweren Verkehrsunfall handelt. Sagt über Funk Bescheid, wir schicken dann Kräfte nach.“
Kaum, dass sich der Transport in Bewegung gesetzt hatte, begannen wir wie die Rohrspatzen zu schimpfen. Dem Verkehrspolizisten empörte die Weisung, selbst schwere Verkehrsunfälle „links liegen zu lassen“,. „Was sollen denn die Bürger von uns denken“, schimpfte die „Weisse Maus“ und tippte sich dabei mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. „Denken die wirklich, dass uns jemand eine Falle stellt? Wird langsam Zeit, sich nach einer anderen Arbeit umzusehen. Die werden doch hier immer bekloppter!“
Die Fahrt ging über Friedesdorf-Dolgelin-Libbenichen-Lebus und von dort weiter nach Frankfurt (Oder).
Ohne das kleinste Vorkommnis erreichten wir dreißig Minuten später das imposante, ehrwürdige Gebäude der „Bezirksregierung“. Das heute übrigens die Europauniversität „Viadrina“ beherbergt. Fleißige Hände halfen bei der Entladung des grünen Lastwagens. Gemächlich, noch immer über die übertriebenen Sicherheitsvorkehrungen diskutierend, fuhren wir zurück nach Seelow. „Vorläufig kann ich das Wort Wahlen nicht mehr hören“, stöhnte der Verkehrspolizist. Wir anderen konnten ihm nur beipflichten. Ohne zu ahnen, dass diese Kommunalwahl der gesamten DDR noch „schwer im Magen liegen“ wird.
Hauptmann He. versteht die Welt nicht mehr

Einmal im Monat fand im Schulungsraum, eine obligatorische Parteiversammlung statt. Unsere Parteigruppe setzte sich aus den Mitarbeitern der Dienstzweige Schutzpolizei, Verkehrspolizei und Feuerwehr zusammen. Zunächst deutete nichts daraufhin, dass diese Parteiversammlung im Mai 1989, einen anderen Verlauf als die vielen hundert vorangegangenen Versammlungen nehmen könnte. Wie stets, wurde die Versammlung vom Vorsitzenden der Parteigruppe, Hauptmann der Feuerwehr Erwin He., eröffnet.
He., der zu den Urgesteinen im VPKA Seelow zählte, stand nicht nur der Parteigruppe, sondern auch der Feuerwehrabteilung vor. Ihm unterstanden, neben einer Sekretärin, vier für die Ausbildung und Anleitung der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Seelow verantwortliche Instrukteure.
Kerzengerade trat der knapp sechzigjährige, kräftig gebaute Offizier, hinter das Rednerpult. Auf dessen Vorderseite unübersehbar das Wappen der SED prangte.
In den kommenden zehn Minuten, lobhudelte He. die Politik der DDR. Ausführlich ging er dabei auf das Wahlergebnis ein. Für ihn ein weiterer Beweis, für das hohe Ansehen der Partei und Staatsführung innerhalb der Bevölkerung.
Mit markigen Worten schwor er die Anwesenden auf den bevorstehenden vierzigsten Jahrestag der DDR ein: „Genossen, nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann!“
Wer gehofft hatte das He. in seiner Rede auch auf den Abbau der Grenzanlagen in Ungarn eingehen würde, sah sich getäuscht.
In der beschränkten Welt des alten Feuerwehrhauptmanns, gab es keinen Platz für solche Meldungen. Kaum jemand hörte den Ausführungen zu. Wäre es in der Rede nicht explizit um die erst kurze Zeit zurückliegenden Kommunalwahlen gegangen, hätte He. auch unbemerkt von irgendeinem zwei Jahre altem Manuskript ablesen können
„So Genossen, und nun freue ich mich auf eine rege Diskussion“, sagte He. zum Abschluss. Wobei er freudig strahlend, erwartungsvoll in die Runde schaute.
Selbstverständlich erwartete Erwin He. an dieser Stelle keine Diskussion. Jedenfalls keine Diskussion nach heutigen Maßstäben.
Im Verständnis der SED stellten Diskussionen nicht etwa den Austausch verschiedener Meinungen dar. Sondern lediglich das in Nuancen variierte, Nachplappern vorgegebener Meinungen.
Jede Abweichung von der vorgefassten Norm und war sie auch noch klein, wurde als Blasphemie angesehen.
Oberleutnant Erich Pa. meldete sich als erster zu Wort. Als Feuerwehrinstrukteur, gehörte der Mittdreißiger zu He.s Abteilung. Gönnerhaft lächelnd, nickte ihm der Hauptmann zu. Wie ein Lehrer seinem Musterschüler.
Pa. schien erregt zu sein.
Sekundenlang suchte er nach den passenden Worten:
„Die erzielten Erfolge der bisherigen Politik, stehen für mich in keinem Zweifel“, begann der Oberleutnant zögernd, „aber wir dürfen nicht nur über Erfolge reden! Sondern auch über Dinge, die weniger gut sind. Zum Beispiel die absolut desolate Ersatzteilversorgung in der Landwirtschaft des Kreises. Dort fehlt es teilweise an den simpelsten Dingen.
Erst gestern war ich zu einer Brandschutzkontrolle in Friedersdorf. Die Leute haben mir ihr Leid geklagt. Mensch, wenn die Bauern nicht so kreativ wären und hier und da improvisieren, würde sich schon bald kein Rad mehr drehen. So sieht es doch aus!“
Erleichtert, so als wäre eine große Last von ihm abgefallen, setzte sich Pa. wieder auf seinen Stuhl. Ungläubig, sichtlich über die Ausführung verärgert, legte Hauptmann He. die Stirn in Falten.
Gebannt hatten die übrigen Anwesenden den mutigen Worten des Oberleutnants zugehört. Kaum jemand konnte sich erinnern, so etwas schon einmal erlebt zu haben.
Als nächster erhob sich der drahtige Hauptmann Wolfgang Hö., dem als Betriebsschutzoffizier die angesprochene Misere bestens bekannt sein durfte. Aber würde er den Mut besitzen, dieses Wissen vor dem „Betonkopf“ He. auszubreiten und damit dessen
Ungnade zu riskieren? Ja, Hauptmann Hö. besaß den Mut, Pa.s Worte nicht nur zu bestätigen, sondern mit eigenen Erfahrungen zu untermauern.
He. wollte seinen Ohren nicht mehr trauen. Als weitere Mitarbeiter des VPKA statt Lobeshymnen zu singen, Klartext redeten, beendete er unwirsch die Diskussion. „Sagt mal, was ist denn in euch gefahren?“, schimpfte er wütend. „Lasst uns hier keine Fehlerdiskussion vom Zaun brechen. Die Hetze sollten wir dem Gegner überlassen.“
Dann begann er einen Rundumschlag, um die „Abweichler“ wieder auf Linie zu bringen. Zuerst wandte er sich an Oberleutnant Pa.: „Hast du nicht erst vor kurzem mit deiner Familie ein Eigenheim bezogen?“, erkundigte sich He. lauernd.
Pa. bejahte die Frage verständnislos. Stand sie doch in keinem Zusammenhang mit dem von ihm aufgeworfenem Problem.
He. erhob drohend den Zeigefinger:
„Was meinst du denn, wem du dieses Eigenheim zu verdanken hast?“
Ehe der Oberleutnant reagieren konnte, gab He. die Antwort selbst: „Der großzügigen Politik der SED. Die du gerade diffamiert hast. In meinen Augen bist du einfach nur undankbar!“
Resigniert winkte Pa. ab. Es hat ja doch keinen Zweck, stand ihm in Leuchtschrift ins Gesicht geschrieben. „So etwas wie heute, möchte ich nie wieder erleben“, donnerte He. zum Abschluss der Veranstaltung. „Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder klar im Kopf seid.“
An diesem Vormittag im Mai des Jahres 1989 zeigten sich die ersten Risse in der festgefügten Welt des altgedienten Feuerwehrhauptmannes Erwin He. Schon wenige Monate darauf, sollte sie völlig zusammenbrechen.
Angetreten zum Appell

In der DDR besaß jede Organisation ihren eigenen Ehrentag. Für die Volkspolizei hatte man dafür den 01. Juli auserwählt. An diesem Tag regnete es geradezu Orden, Prämien und Beförderungen. Diese Segnungen trafen jedoch nicht jeden. Wer im vergangenen Jahr in „auffällig“ wurde, ging leer aus. Anreiz genug aus dem wie auch immer gearteten Fehler zu lernen. Um im kommenden Jahr wieder zu dem illustren Kreis der Ausgezeichneten zu gehören.
Wie in jedem Jahr, fand der Ehrenappell auch diesmal wieder im Innenhof des Volkspolizeikreisamtes statt. Punkt 09:00 Uhr trat die gesamte Belegschaft, mit Ausnahme des „Operativen Diensthabenden“, zur „Bescherung“ an. Dem Anlass entsprechend in Paradeuniform. Mit Ausnahme der Kriminalisten. Aber auch diese hatten ihre besten Anzüge aus dem Schrank geholt. Während die weiblichen Zivilangestellten in ihren weinroten Kostümen am Appell teilnahmen.
Hochrangige Gäste, darunter Rainer Pa., der 1. Sekretär der SED-Kreisleitung, standen zur Gratulation bereit.
Zur Eröffnung des Appells erfolgte ein bizarr anmutendes, militärisches Ritual:
Major W., der amtierende Stabschef, marschierte im zackigen Stechschritt, der einem preußischen Feldwebel zur Ehre gereicht hätte, auf den 1. Sekretär zu. Einige der Angetretenen konnten sich nur mit Mühe ein Grinsen verkneifen.
Der Major legte die rechte Hand an den Mützenschirm und meldete: „Genosse 1. Sekretär, der Bestand des Volkspolizeikreisamtes Seelow ist zum Appell anlässlich des heutigen Ehrentages angetreten.“
Major W. wäre wohl bei der Armee besser aufgehoben. Pa. nickte ihm dankbar zu. Ehe er ein: „Guten Tag, Genossen Volkspolizisten“ über den Hof schmetterte. „Guten Tag, Genosse 1. Sekretär“, antworteten die angetretenen Polizisten im Chor.
Anschließend begab sich Pa. hinter das aufgestellte Rednerpult. In ebenso markigen wie austauschbaren Sätzen, würdigte er die Arbeit des VPKA Seelow. Dabei schwor er die Belegschaft auf die bevorstehenden, ganz im Zeichen des nahenden „Vierzigsten Republikgeburtstages“ ein.
Als nächster hielt Oberstleutnant N. seine obligatorische Ansprache.
Zuerst verlas er die Grußworte des „Ministers des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei“, Armeegeneral Friedrich Dickel. Wieder die üblichen allgemein gehaltenen Dankesworte. Denen kaum jemand zuhörte. In Gedanken rechnet sich jeder vielmehr noch einmal die eigenen Chancen aus, heute zu den Ausgezeichneten zu gehören. Keiner möchte leer ausgehen, enttäuscht den Platz verlassen. N.s langatmige Rede verlangte höchste Geduld und Standfestigkeit.
Ein Volkspolizist fehlte an diesem Tag:
Hartmut Ha., ein erst im vergangenen Jahr eingestellter Unterwachtmeister.
Er wird auch in den kommenden Jahren an keinem Appell mehr teilnehmen. Denn Hartmut gehört seit kurzem nicht mehr dazu. Weil er sich für die aus kaderpolitischer Hinsicht „falsche“ Frau entschieden hatte. Deren Makel einzig und allein darin bestand, verwandtschaftliche Beziehungen zu ihrem in der Bundesrepublik lebenden Cousin zu unterhalten.
„Entweder du trennst dich von der Frau, oder wir trennen uns von dir“, so lautete die knallharte Forderung der Seelower Polizeiführung. Im Rahmen einer Aussprache, zu der man das Paar ins VPKA zitiert hatte.
Hartmut war mit Leib und Seele Volkspolizist. Dennoch wäre ihm nie im Traum eingefallen, sich von der zukünftigen Ehefrau zu trennen.
Bei dem Versuch den „verstockten“ Genossen umzustimmen, schreckte die Führung selbst vor unmoralischen Angeboten nicht zurück.
Als Hartmut das „Tribunal“ auf die fortgeschrittene Schwangerschaft seiner Auserwählten hinwies, sagte der Amtsleiter: „Das ist doch ein Problem. Du wirst am 1. Juli zum Wachtmeister befördert, bekommst damit also mehr Geld. Womit du dann die Alimente für das Kind bezahlen kannst.“
Das war nicht nur zynisch, sondern obendrein extrem Menschen verachtend!
Hartmut verzichtete „dankend“ auf die in Aussicht gestellte Beförderung und kündigte sofort. Hinter verschlossenen Türen schlugen die Wellen der Empörung über die unwürdige Behandlung des sympathischen Kollegen hoch. Offiziell ergriff jedoch niemand Partei für ihn. Sei es aus Feigheit oder der Erkenntnis „ohnehin nichts dagegen ausrichten zu können“.
Endlich war der Oberstleutnant an den Schluss seiner mehrseitigen Rede angelangt.
Nun endlich erfolgte der ersehnte Höhepunkt des Tages, der erfahrungsgemäß durchaus auch mit einer Enttäuschung enden konnte.
Hauptmann Sylvia Rei. verlas Dienstgrade und Namen der für eine Beförderung Vorgesehenen.
Im Gießkannenprinzip wurden im Anschluss an die Beförderungen die begehrten Prämien und Orden verteilt. Wer einen Orden bekam, konnte sich gleich doppelt geehrt fühlen. Hing doch an jedem Stück Blech, eine zusätzliche Geldsumme.
Es war für mich völlig überraschend, dass auch ich zu den Geehrten gehörte. Schließlich war ich doch erst seit knapp einem Jahr im VPKA. Man verlieh mir die mit zweihundert Mark zusätzlich versüßte „Medaille für ausgezeichnete Leistungen in den Organen des MdI“.
Auch wenn dieser Orden laut Statistik quasi jedem Volkspolizisten irgendwann einmal verliehen wird, erfüllte mich die Auszeichnung doch mit gewissem Stolz.
Nach dem Appell hatten sich die Ausgezeichneten und Beförderten der Abteilung noch einmal beim S-Leiter melden.
Auf der Seelower Kreisseite widmete sich an diesem Tag der „ Neue Tag“ ausführlich, in Wort und Bild, der Arbeit der Volkspolizei im Kreis Seelow. Eines der Fotos zeigte zwei Schutzpolizisten vor dem Streifenwagen. Von anderen Bildern lächelten Verkehrspolizisten und Mitarbeiterinnen der Meldestelle den Leser an.
Dem Auftrag entsprechend, wurde eine Verbundenheit zwischen (Volks)Polizei und Bevölkerung suggeriert, die es so in der Realität so leider nicht gab. Die Wirklichkeit sah anders aus. Von vielen wurde die VP als stumpfsinniger Vollstrecker des Staates gesehen. Bürokratische, oft nicht nachprüfbare Entscheidungen und das von den Bürgern als „obrigkeitsstaatliches Gebaren“ empfundenen Verhalten einiger Polizisten prägten vielmehr das Bild des Volkspolizisten in der Öffentlichkeit. Davon las man jedoch (noch) nichts in den Zeitungen.
Wetterleuchten über dem Puschkinplatz

Nur wenige Tage befreite mich ein Erlebnis während einer abendlichen Fußstreife, von meinem Selbstbetrug.
Ein herrlicher Sommertag neigte sich seinem Ende zu.
Über der damals turmlosen Kirche Seelows brachte ein malerischer Sonnenuntergang den Himmel zum erglühen. Auf dem Puschkinplatz versammelten sich mehrere Gruppen junger Leute. Die meisten von ihnen kamen von einer Discoveranstaltung im nahen Kulturhaus, die an Wochentagen bereits gegen 22:00 Uhr endete. Der herrliche Sommerabend hielt die jungen Leute offensichtlich davon ab, rasch nach Hause zu gehen.
Rasch füllte sich der um diese Zeit sonst menschenleere Platz im Herzen der Kreisstadt.
Erfahrungsgemäß trugen Personenansammlungen, besonders um diese späte Stunde, einiges Potential für Ordnungswidrigkeiten oder sogar Straftaten in sich.
Jugendliches Imponiergehabe und Alkohol hatten bereits zu Großvaters Zeiten die Gendarmen beschäftigt.
Aber an jenem Abend lag mehr in der noch immer warmen Luft, als nur ein paar harmlose Jugendstreiche.
Natürlich blieb mir der ungewöhnliche Menschenauflauf nicht verborgen.
Die Tanzveranstaltungen im Kulturhaus bereiteten der Seelower Polizei ohnehin einiges an Kopfzerbrechen.
Sachbeschädigungen, aber auch Körperverletzungen waren an der Tagesordnung, ohne dass die Polizei immer sofort einschreiten konnte.
Um dem ganzen vorzubeugen, hatten die Streifenpolizisten dem Umfeld des Kulturhauses ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Das war leichter gesagt, als getan.
Besonders dann, wenn sich ein einzelner Polizist um die Flausen mehrerer hundert Jugendlicher zu kümmern hatte.
So erging es mir an jenem Abend. Der Beginn der Urlaubssaison sorgte wie in jedem Jahr für Chaos bei der Dienstplanung. Der erfahrene kluge Polizist geht in solchen Nächten jeglichem Ärger aus dem Weg, da er ohnehin ganz auf sich allein gestellt ist.
Aber als junger, knapp fünfundzwanzigjähriger Hauptwachtmeister und frisch gekürter Medaillenträger, sieht man die Welt mit anderen Augen. Erfüllt von Pflichtgefühl und mit dem trügerischen Gefühl der eigenen Unverletzlichkeit, beschloss ich auf dem Puschkinplatz polizeiliche Präsenz zu zeigen. Die Jugendlichen sollten wissen, dass die Staatsmacht ein waches Auge auf sie hat.
Zu diesem Zwecke stellte ich mich auf die obere Treppe der altehrwürdigen „Adlerapotheke“. Hier wurden schon Pillen verkauft, als Seelow noch in Preußen lag und von einem König regiert wurde.
Nun stand ich hier, als unübersehbarer Repräsentant der Staatsmacht, gewandet in die grüne Uniform der Volkspolizei.
Wie Gojko Mitic ließ ich meinen Blick über den Platz schweifen, vom Schäferbrunnen hinüber zum „Cafe Schmidt“ und der HO-Gaststätte „Oderbruch“.
Überall standen in losen Gruppen, diskutierend und gestikuliert, junge Leute.
Schon hörte ich die ersten Schmährufe gegen die Polizei, ausgestoßen aus der Anonymität der Gruppe: „Hau ab Bullenschwein“, brüllte ein mit einem blauen Jeansanzug bekleideter Jugendlicher. Es folgten Pfiffe und Buhrufe, schon bald schlugen irgendwo leere Flaschen klirrend aufs Pflaster.
Ich verspürte ein unbehagliches Gefühl in der Magengegend, beschloss aber, trotzdem auf der Stelle zu verharren.
„Wir wollen endlich Freiheit haben und nicht mehr eingesperrt sein“, rief mir junges, höchstens achtzehnjähriges Mädchen zu.
„Heute haben schon wieder ein paar tausend euren Lügenstaat verlassen, bald sind wir auch weg“, hallte es aus einer anderen Gruppe.
Jetzt dämmerte es mir der Grund für die spätabendliche Versammlung:
Die jungen Leute wollten über die seit Wochen herrschende, von offizieller Seite noch immer verschwiegene Ausreisewelle diskutieren. Da von den Erwachsenen anscheinend niemand mit ihnen über dieses Problem sprach, wollten sie sich nun Gehör verschaffen.
Und sie taten es, auf eine ebenso unüberhörbare wie unfassbare Art und Weise. Einige von den Anwesenden kannte ich flüchtig, die Mutter eines Mädchens arbeitete als Zivilangestellte bei der Abteilung „Pass und Meldewesen“ im Kreisamt.
Mir standen keine Rowdys, sondern ganz normale, anständige junge Leute gegenüber. Gut, einige von ihnen schienen angetrunken zu sein und spielten die üblichen provokanten Spielchen. Aber den meisten ging es nur darum, dem angestauten Frust freien Lauf zu lassen.
Zu meiner großen Überraschung befanden sich auch junge polnische Erntehelfer unter den Anwesenden.
Vor einem Jahr war es noch zu einer Prügelei zwischen Deutschen und Polen gekommen, heute verbrüderten sie sich! Das war gelebte Völkerfreundschaft, hatte aber mit der von der SED stets propagierten nichts gemein.
Ein seltsames Stimmengemisch zelebrierte eine Lobeshymne auf die „Solidarnocz“ und Lech Walesa. Einige von den Mädels tanzten ausgelassen in froher Stimmung, jeder einzelne von den gut zweihundert Jugendlichen schien geradezu von einem ausgelassenen Siegestaumel erfasst zu sein. Immer wieder hallten die lauten Rufe nach Freiheit, durch das nächtliche Seelow. Unverhohlener Spott und Hohn schlugen mir entgegen, keine Spur von Vertrauen oder gar Respekt gegenüber der Volkspolizei, wie der „ Neue Tag“ doch seinen Lesern zu suggerieren versuchte.
Ich verharrte derweilen noch immer auf der Treppe aus. Meine rechte Hand umklammerte unschlüssig das Mikrofon meines Funkgerätes.
Sollte ich dem „Operativen Diensthabenden“ nun Meldung erstatten, oder nicht?
Meldung worüber? Etwa wegen vermeintlich „staatsfeindlicher Äußerungen“, die ohne meine Anwesenheit möglicherweise überhaupt nicht gefallen wären?
Ich zog mich langsam zurück, in Richtung Breite Straße. Hinter mir hörte ich noch immer die höhnischen Rufe aus Menge, die sich bald nach Hause begab. Ich fühlte mich elend, wie erschlagen.
Dagegen hatten die jungen Leute allen Grund zum Jubeln. Sie hatten Stärke und Mut bewiesen, auch, oder gerade wegen meiner Anwesenheit, Klartext zu sprechen.
Unter dem Eindruck des Erlebten, zog ich von dannen wie ein geprügelter Hund. Es ist wahrlich kein schönes Gefühl, besiegt worden zu sein.
Mein Erlebnis, sosehr es mich auch traf, sollte jedoch nur ein leiser Vorgeschmack auf viel turbulentere Ereignisse sein. Es war gewissermaßen nur das ferne Wetterleuchten eines schweren Gewittersturms.
In der späteren lokalen Geschichtsschreibung wurde immer wieder behauptet, dass die erste Demonstration des Wendejahres 1989 in Seelow unmittelbar nach dem Mauerfall stattfand. Das stimmt jedoch nicht! Die erste, wenn auch inoffizielle Demonstration, ging, von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, an einem warmen Sommerabend im Juli 1989 über die Bühne. Zu einem Zeitpunkt, als es noch Mut erforderte, dem Staat die Meinung zu sagen!
Ein Hoch auf die „herrliche DDR“
Das „passende Kontrastprogramm“ bekam ich wenige Tage darauf geliefert.
Ohne Vorwarnung beorderte mich Major Bie. zu einem dreitägigen Politlehrgang für FDJ-Vorsitzende.
„Ich bin doch bloß der Stellvertreter“, maulte ich wenig erfreut. „Stimmt, aber der Vorsitzende ist dienstlich verhindert. Also wirst du ihn vertreten! Das ist ein Befehl!“
Ich hätte es mir ja auch gleich denken können! Leutnant Fred A., FDJ-Vorsitzender und Instrukteur der Feuerwehr, drückte sich grundsätzlich vor solchen Lehrgängen.
In mir hatte der Leutnant den in jeder Hinsicht geeigneten Stellvertreter gefunden, auf dem man unliebsame Aufgaben jeder Zeit abwälzen konnte.
Der Lehrgang fand im Schulungs- und Ausbildungsobjekt der BdVP, in Kunitz-Loose statt.
Einer früheren Kaserne der Grenzpolizei, ruhig gelegen, unmittelbar am Oderdamm, irgendwo zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt.
Zwei Dinge sind mir im Gedächtnis haften geblieben:
Zum einen die Begegnung mit einem waschechten „Kundschafter des Friedens“. Der sich bei näherem Hinsehen als desillusionierter, müder alter Ma. erwies. Mit Spannung erwarteten wir dessen Ankunft. Wann bekommt man schon einmal die Möglichkeit, aus erster Hand Einblick in die geheime Welt der Spionage zu bekommen. Zunächst nahm kaum einer der Kursanten den grauen, schmalen Endfünfziger beim Betreten des Schulungsraums wahr. Der vor ihm gehende, breitschultrige, durchtrainierte dunkelhaarige elegante Anzugträger zog sämtliche Blicke auf sich. Das Musterbild eines sozialistischen James Bond, dachte ich frenetisch. Irgendwie besaß der Typ eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Giso Weißbach.
Ein Oberleutnant der Politabteilung, unter dessen Obhut der Lehrgang stand, begrüßte überschwänglich die Gäste. Zuerst stellte er den Giso-Weißbach-Verschnitt als einen Hauptmann, den Namen habe ich vergessen, von der Bezirksverwaltung für Staatssichereit Frankfurt (Oder) vor. Nicht er, sondern sein unscheinbarer Begleiter war der mit Spannung erwartete „Kundschafter“.
Wir hingen förmlich an den Lippen des Ma.es, als er uns von seinem Wirken an der
„Unsichtbaren Front“ berichtete.
Wer jedoch spannende Agenten-Stories erwartetet, wurde bald enttäuscht.
Das vermeintlich spannende jahrzehntelang in der Bundesrepublik geführte Doppelleben, verlief völlig unspektakulär. Noch vor dem Mauerbau war er im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit in die Bundesrepublik gegangen. Als so genannter „Perspektivagent“. Gemeinsam mit seiner ebenfalls im Dienst des MfS stehenden Ehefrau.
Zunächst fand er eine Anstellung in einem Chemie-Konzern. Fleißig und zielstrebig, gelang es ihm die Karriereleiter immer höher zu steigen. Wobei er, nicht minder fleißig, dass MfS über Konzern-Interna informierte. Im Laufe der Jahre fühlte er sich in seiner schizophrenen Rolle immer weniger wohl.
Er brachte das zwar nicht direkt im Gespräch zum Ausdruck, aber dem aufmerksamen Zuhörer blieb der Unterton nicht verborgen.
Anders ausgedrückt: der Agent war mittlerweile zum Bundesbürger geworden, der sich im Kollegenkreis wohlfühlte, dem seine Arbeit Freude bereitete und der doch Freunde und Arbeit verraten musste!
Eines Tages stand eine Sicherheitsüberprüfung an. Irgendjemand schien dem Agenten auf die Spur gekommen zu sein. Zumindest konnte eine Enttarnung nicht ausgeschlossen werden. Sicherheitshalber beorderte die Zentrale den Kundschafter und dessen Ehefrau zurück in die DDR. Die ihm doch längst völlig fremd geworden war.
Von einem Kursteilnehmer nach seinen Eindrücken bei der Rückkehr befragt, antwortete der Befragte ein wenig zögerlich:
„Ich muss schon sagen, dass ich doch etwas enttäuscht war. Wenn ich so den Zustand der Straßen und Häuser sehe, da ist schon noch sehr viel im Argen!“
„Giso Weißbach“ warf ihm darauf einen missbilligenden Blick zu.
Ohne sich darum zu kümmern, erzählte er uns, dass sich seine Ehefrau in psychologischer Behandlung befinden würde. Sie hatte den Wegzug aus der BRD und den Verlust ihrer Freunde, ganz und gar nicht verkraftet.
Aber es gab noch eine weitere schwere Belastung für die angeschlagene Psyche der Frau:
Sie hatte sich stets sehnlich ein Kind gewünscht. Aus Sicherheitsgründen hatte die Zentrale jedoch angewiesen, dass die Ehe kinderlos zu bleiben hat. Bereits daran ist die Frau beinahe zerbrochen. Die überhastete Flucht in die DDR hatte ihr wohl den Rest gegeben.
Abrupt beendete der begleitende Stasi-Offizier das Gespräch, einen angeblich weiteren dringenden Termin vorschiebend. Ich verspürte unbändiges Mitleid mit dem armen Mann. Ganz sicher fühlte ich nicht allein so. Zurück blieb ein seltsam schales Gefühl bei allen Zuhörern.
Das zweite Ereignis fand am Vorabend der Abreise statt. Oberst Re., der oberste Politoffizier in der BdVP Frankfurt (Oder), hatte sich zum feierlichen Umtrunk angemeldet.
Mit dem traditionell der Lehrgang beendet werden sollte.
Die Feier fand im Schulungsraum statt. Der Oberleutnant hatte eigens zu diesem Anlass einen Plattenspieler besorgt. Auf dem Teller drehte sich eine Amiga-LP des „Oktoberklubs“.
Ganze Batterien von Wodka und Kognak und Bierflaschen harrten ihrer Vernichtung. Während sich auf den Tellern belegte Brötchen türmten.
Oberst Re., ein etwas untersetzter, über fünfzig Jahre alter Offizier, hielt zur Eröffnung eine flammende Rede. Je mehr er redete, desto freudiger leuchteten dabei seine grauen Augen.
So ein Abend wie dieser, war offenbar ganz nach seinem Geschmack.
Nach dem er seine Rede beendet hatte, hob Re. das bis zum Eichstrich mit „Goldbrand“ gefüllte Glas, brachte einen Trinkspruch auf die „herrliche DDR“ aus und stürzte das scharfe Getränk, in einem Zug hinunter. Wir taten es ihm gleich.
Euphorisch verlangte Re. von jedem einzelnen, dass dieser im Laufe des Abends einen Toast auf die DDR ausbringt.
Man bedenke: im Raum saßen die „FDJniks“ sämtlicher VP-Dienststellen, wozu auch Strafvollzug und Feuerwehr gehörten, des Bezirks Frankfurt (Oder). Wenn der letzte an der Reihe war, würden die ersten bereits selig unterm Tisch liegen!
Ich kam als dritter dran. Mir fiel jedoch kein passender Spruch ein. „Die DDR ist super, Prost Genossen“, zelebrierte ich hilflos grinsend.
„Ist das ihr Ernst, Genosse Hauptwachtmeister?“, grummelte Re., der wohl einen schmissigeren Slogan erwartet hätte.
„Ja, doch. Warum nicht?“, versuchte ich mich zu rechtfertigen und stürzte den Fusel tapfer hinunter.
Irgendwann waren wir alle so besoffen, dass sich kaum noch einer auf den Stühlen halten konnte.
„Sag mir wo du stehst?“, fragte der Oktoberklub in intonierte Verse verpackt. Und wir sangen lautstark mit. „Wenn ich bloß stehen könnte“, gluckste albern mein linker Tischnachbar, ein Gefängniswärter aus Rüdersdorf.
Zwischendurch erklangen immer wieder Trinksprüche auf die „herrliche DDR“.
Der viele Alkohol tauchte meine Gedanken in ein Nebelmeer.
Re. schwadronierte über die unwahrscheinlichen Möglichkeiten, welche die DDR der heutigen Jugend bietet. Möglichkeiten, die seiner Generation noch verwehrt geblieben waren.
„Und eines sage ich euch Genossen: der überwiegende Teil der DDR-Jugend steht fest hinter den Zielen der SED!“, verkündete Re..
Bewege mal deinen Arsch heraus auf Streife. Dann wirst du sehen und hören, wie die Jugend tatsächlich über uns denkt. Diese und ähnliche Gedanken kämpften in meinem Kopf gegen die bleierne, vom Trinken ausgelöste Trägheit.
Oberst Re. kramte zwischen den Schallplatten umher. Es dauerte ein wenig, bis er die passende Scheibe gefunden hatte.
„Vorwärts Freie Deutsche Jugend, der Partei unser Vertrauen“, schallte es gleich darauf dröhnend aus dem Lautsprecher. Beschwingt bewegte sich der Offizier im Takt auf dem Stuhl umher.
In immer kürzer werdenden Abständen wurden die Gläser gefüllt und sofort wieder geleert. Solch eine makabre Szenerie kann man tatsächlich nur besoffen zu ertragen!
„Achtung“, brüllte Re.. Wie von einer unsichtbaren Feder getroffen, sprangen wir von den Plätzen auf. Bier und Schnapsgläser stürzten um. Schaler Geruch breitete sich aus. Oberst Re. gab stieß wieder einmal auf die DDR an. „Dem Sozialismus in seinem Lauf, hält weder Ochs noch Esel auf“, lallte der oberste Politoffizier der Frankfurter Volkspolizeibezirksbehörde selig.
Peinliche Szenen, die ich am liebsten aus meinem Gedächtnis streichen würde.
Wer den Zustand, in dem sich die Volkspolizei im Sommer 1989 ehrlich beschreiben will, kommt daran aber nicht vorbei. Kollektive Besoffenheit in „Tateinheit“ mit blindem Gehorsam. Deutlicher kann man die damalige Misere wohl nicht zum Ausdruck bringen!
Irgendwann kurz vor oder nach Mitternacht hatte das Spektakel ein Ende gefunden.
Sinnlos betrunken, wankten die Teilnehmer in die Zimmer zurück.
Während dessen brachen überall im Land wieder unzählige Bürger auf, um der „herrlichen DDR“ für immer den Rücken zu kehren.
Ein unverhoffter Karrieresprung
Mein Spaß an der Arbeit bei der Schutzpolizei näherte sich bedrohlich dem Nullpunkt. Hauptmann T. konfrontierte uns eines schönen Sommertags mit einem Fernschreiben der Bezirksbehörde der Volkspolizei Frankfurt (Oder). Per Telex hatte die Polizeiführung angewiesen, dass die Funkstreifenwagen ab sofort nicht mehr als zehn Kilometer pro Schicht zurücklegen durften.
Zehn Kilometer? Selbst in einer Kleinstadt wie Seelow dürfte das schmale Limit in kürzester Zeit ausgereizt sein. Von nun an durfte der Funkstreifenwagen nur noch für „überörtliche Einsätze“ genutzt werden. Über den Einsatz durfte selbst der Operative Diensthabende nicht mehr allein entscheiden. Bevor der Funkstreifenwagen vom Hof rollte, musste sich der „ODH“ zunächst die Zustimmung vom „Leitungsdienst“ einzuholen. Wie üblich, blieb man uns die Begründung für diese drastische Sparmaßnahme schuldig. „Die DDR ist pleite“, witzelte ein Kollege. Ohne zu ahnen, wie nahe er der Wahrheit so eben gekommen war.
Am Tag blieb der Streifenwagen ohnehin überwiegend auf dem Hof. Als Fußstreife Präsenz zu zeigen, hatte sich als durchaus effektive Einsatzform bewährt. Aber im nächtlichen Kampf gegen Diebe und Verkehrsrowdys, die es auch schon in der DDR gab, sollte schon Chancengleichheit bestehen!
Politoffizier Artur Bie. gab sich jedenfalls redlich Mühe, die schwachsinnige Anweisung als „Effektivitätssteigerung“ darzustellen. Ein Wachtmeister zu Fuß sieht und hört mehr, als eine durch die Stadt rollende Funkstreifenwagenbesatzung. Basta! Das naheliegende Argument, dass ein Wachtmeister zu Fuß motorisierten Verkehrssündern allenfalls grimmig hinterher schauen kann, fruchtete da nur wenig. Major Bie. verfolgte stur die aus Frankfurt und Berlin vorgegebene Linie. Etwas anderes blieb ihm wohl auch kaum übrig. Selbst wenn er gewollt hätte.
Im Juli erhielten wir die Weisung, während der Streife auf unter anderem an Autoantennen angebrachte weiße Bänder acht zu geben. Zur Erklärung sagte man uns, dass Ausreiseantragssteller mittels dieser weißen Bänder in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für ihre Situation erreichen wollen.
Ja, aber wer denkt denn gleich an Ausreiseantragsteller, bloß weil irgendwo ein weißes Band im Wind flattert?
Während eines Streifengangs stieß ich tatsächlich auf ein solches „corpus delicti“. Was sich jedoch als völlig harmlos herausstellte. Der Besitzer, übrigens ein VP-Helfer, hatte kurz zuvor geheiratet und einfach nur vergessen, dass dämliche Band zu entfernen. Angesichts der Blamage verzichtete ich in Zukunft auf die „Bänderjagd“.
An einem heißen Vormittag im August wurde ich überraschend ins Dienstzimmer des S-Leiters bestellt.
Auf dem kurzen Weg vom VPKA in die Breite Straße ging in Gedanken mein Sündenregister durch. Zum Chef gerufen zu werden, bedeutet selten etwas Positives.
Vielleicht hat sich ja mal wieder jemand über mich beschwert, dachte ich voll bangem Unbehagen. Die Tür von T.s Büro stand sperrangelweit offen.
Der Hauptmann saß wie immer an der Stirnseite des großen Konferenztisches. So als wäre er dort irgendwann festgewachsen. Jeder der ihn dort sah fragte sich unwillkürlich, wie lange sein immer üppiger werdender Bauch noch zwischen die Tischplatte passen würde.
„Da bin ich“, sagte ich salopp. Normalerweise gehörte Hauptmann T. nicht zu denen, die großen Wert auf militärische Umgangsformen legten.
Diesmal knurrte er jedoch ein „Soll das etwa eine vorschriftsmäßige Meldung sein?“, entgegen. Kenne sich einer mit diesen Vorgesetzen aus! Mein Unbehagen verstärkte sich weiter.
Grundstellung einnehmend, die rechte Hand an den Mützenschirm legend, schnarrte ich:
„Genosse Hauptmann, Hauptwachtmeister Bräuning auf ihren Befehl zur Stelle.“
Hauptmann T. nickte befriedigt und bedeutete mir Platz zu nehmen. Ohne langes Drumherumgerede, kam er sofort zur Sache: „Du möchtest doch ABV werden? Oder hast du
es dir schon anders überlegt?“ „Nein“, antwortete ich verunsichert. Schließlich war ich wegen des geplanten Studiums erst vor kurzem in Begleitung T.s erst vor zwei Wochen in der Bezirksbehörde gewesen. Wo mir mein Mentor, ein Oberleutnant aus dem VPKA Fürstenwalde, vorgestellt wurde. Also, was sollte die Frage?
T. zündete sich eine Zigarette an, blies den Rauch an die Zimmerdecke und wandte mir wieder das Gesicht zu: „Der Genosse L. beginnt ab September sein einjähriges Direktstudium an der ABV-Schule in Pretzsch. Damit wäre sein Abschnitt für ein ganzes Jahr unbesetzt. Ich könnte den Genossen Hauptmann Lau. bitten, den Bereich des Genossen L. zusätzlich zu übernehmen. Ich könnte aber auch dich fragen, ob du dir das zutraust?“ T. zwinkerte mir aufmunternd zu. Na und ob ich wollte! Erfreut sagte ich sofort zu! „Ich habe auch nichts anderes erwartet“, erwiderte der Hauptmann. „Ab den kommenden Montag wird dich der Genosse L. zunächst zwei Wochen einarbeiten. Ich denke mal das müsste ausreichen, damit du im Abschnitt allein zurechtkommst.“
Also, wenn das keine gute Neuigkeit war! Euphorisch, den Kopf voller Pläne und Vorstellungen, fieberte ich dem besagten Montag entgegen.
Zuvor hatte ich, in der Nacht von Freitag auf Samstag, noch eine Nachtschicht zu absolvieren.
Meine letzte Schicht als „einfacher“ Schutzpolizist! So glaubte ich jedenfalls. Ich teilte mir mit meinem Streifenkollegen die Stadt. Das Wetter zeigte sich geradezu optimal für einen nächtlichen Spaziergang. Selbst nach 22:00 Uhr sank das Thermometer zeigte das Thermometer noch fast fünfundzwanzig Grad Celsius.
Mein Weg führte mich zur SED-Kreisleitung um dort die obligatorische Kontaktaufnahme mit dem diensthabenden Wachmann durchzuführen. Bedächtig trottete ich die hinunter ins Oderbruch führende Straße entlang. Rechter Hand zeichnete sich die Silhouette des vor wenigen Jahren errichteten, überwiegend von NVA-Angehörigen bewohnten Neubaugebietes „Am Stadion“ im diffusen Licht des scheidenden Tages ab.
Ein Jahr zuvor war es hier zu einem tragischen Vorfall gekommen. In der Überzeugung, dass ihr knapp dreijähriger Sohn friedlich in seinem Bettchen schlief, wollte ein Ehepaar eines Abends zu einer kurzen Probefahrt mit dem am selben Tag gekauften Trabbi aufbrechen. Warum das Kind während der Abwesenheit der Eltern erwachte, wird wohl niemand klären. Tatsache ist jedoch, dass der Junge in Panik geriet, das Fenster seines im dritten Stock gelegenen Zimmers öffnete und in die Tiefe stürzte. Ein Unglück, wie es wohl tragischer nicht sein konnte.
Das weißgetünchte Gebäude der SED-Kreisleitung befand sich am östlichen Stadtrand. Erbaut auf einem künstlich angelegten Berg. Antennen und Parabolspiegel zierten das Dach des Hauses.
Ein niedriger Zaun umgab das Areal der Kreisleitung. Kein wirkliches Hindernis, um etwaige zornige Volksmassen von der Erstürmung abzuhalten. Aber damit rechnete zu diesem Zeitpunkt wohl noch keiner.

im Jahre 2011
heute Job-Center Märkisch-Oderland
Außenstelle Seelow
Ich klingelte an der Eingangspforte. Kurz darauf schlurfte der Wächter herbei. Die blaue Uniformen, ohne Rangabzeichen tragenden, mit Makarov-Pistolen ausgerüsteten Sicherheitskräfte der SED-Kreisleitung, unterstanden formal der Abteilung „ Betriebsschutz“ des VPKA. Selbst gehörten die meist über fünfzigjährigen, besonders ausgesuchten Wachleute jedoch nicht der Volkspolizei sondern der SED-Kreisleitung an.
„Guten Abend, alles in Ordnung bei euch?“, begrüßte ich den Wächter. „Was soll hier schon nicht in Ordnung sein“, antwortete er mir gleichmütig. „Ich habe mir gerade Kaffee gekocht. Möchtest du auch einen?“
Dankend nahm ich die Einladung an und folgte ihm ins Gebäude.
In der „Pförtnerloge“ berichtete ich stolz von meinem bevorstehenden Karrieresprung zum Abschnittsbevollmächtigten.
Lächelnd gratulierte mir der Wachmann, während er dampfenden schwarzen Kaffee servierte.
Was sagst du eigentlich zu der politischen Lage“, fragte er mich voller Sorge. „Wo soll das nur enden?“ „Erst tanzen die Polen aus der Reihe und jetzt geschehen in Ungarn genau die gleichen Dinge. Du, ich gebe der DDR noch fünfzehn Jahre. Dann geht das bei uns auch los.“
Ich nahm einen Schluck aus der geblümten Kaffeetasse:
„Meinst du wirklich?“ „Ja, das meine ich. Wenn das so weitergeht, habe ich Angst um den Sozialismus. Nicht das wir eines Tages auch bei uns Arbeitslosigkeit erleben werden.“ „Ach was“, wehrte ich ab. „Soweit wird es schon nicht kommen!“
Ironie des Schicksals: im früheren Gebäude der SED-Kreisleitung Seelow residiert heute das Jobcenter. Beinahe täglich melden sich dort Arbeitslose aus der Region, in der Hoffnung, dass ihnen die oftmals überforderten Sachbearbeiter zu einer neuen Tätigkeit verhelfen können. Viele, zu viele, müssen enttäuscht wieder und wieder von dannen ziehen. Leider hat sich die Befürchtung des Wachmanns in dieser Hinsicht erfüllt. Wären dem Oderland Arbeitslose erspart geblieben, wenn die SED noch immer an der Macht wäre? Diese Frage kann nur mit einem klaren Nein beantwortet werden, ist doch die hohe Arbeitslosenrate eine Spätfolge der verfehlten Politik der SED, die nicht nur das Oderland gründlich ruinierte.
Die ersten Tage im Abschnitt / Willkommen in der Wirklichkeit!

Ungeduldig erwartete ich den kommenden Montag. In meiner überbordenden Phantasie malte ich mir bereits aus, demnächst als Abschnittsbevollmächtigter „große Kriminalfälle“ zu lösen.
Eigenverantwortlich zu arbeiten, rund um die Uhr für Ordnung und Sicherheit sorgen, davon hatte ich doch immer geträumt. Und ich träumte noch immer!
VP-Obermeister L. „beackerte“ den „Abschnitt Dolgelin“. Zu dem, außer Dolgelin noch die Orte Sachsendorf, Libbenichen, Carzig, Alt und Neumahlisch gehörten. In Libbenichen hatte ich ja bekanntlich bis zum Januar dieses Jahres für einige Zeit gewohnt. Nun würde es ein Wiedersehen mit dem Dorf und seinen Bewohnern geben.
Pünktlich um 07:00 Uhr stand ich vor dem Dolgeliner LPG-Büro, unter dessen Dach sich das ABV-Dienstzimmer befand. DEUTSCHE VOLKSPOLIZEI-Abschnittsbevollmächtigter- stand unübersehbar auf einer an der Wand angebrachten gusseisernen Tafel.
Obermeister L. ließ auf sich warten. Endlich näherte sich der amtierende ABV von Dolgelin. Schon von weitem konnte man seinen laut knatternden Skoda hören. „Wer fährt das plundrigste Auto? Unser Sheriff!“, bemerkte grinsend ein vorbeigehender LPG-Bauer.
Gemächlich schraubte sich L. aus dem Fahrersitz. Bevor er zur VP kam, hatte er als Berufssoldat in einer Nachrichteneinheit der NVA gedient. Dort schien es ungewöhnlich gemütlich zugegangen zu sein. Von militärischem Schwung war jedenfalls bei ihm nicht viel zu spüren. Ungeduldig trippelte ich von einem Bein aufs andere.
„Wartest du schon lange?“ „Es hieß doch um sieben Uhr. Oder nicht?“ „Nun sei mal nicht so aufgeregt“, brummte der Obermeister gemütlich.
L.s Standartsatz sollte ich in den kommenden Tagen noch des Öfteren zu hören bekommen.
Zuerst ging es hinein ins LPG-Büro. Wir schritten durch einen langen, links und rechts von Büroräumen gesäumten Flur. Unterwegs begegneten uns zwei gut gekleidete Damen mittleren Alters. L. begrüßte die Frauen höflich und stellte mich bei der Gelegenheit gleich als seinen Vertreter vor. Die Frauen schüttelten mir freundlich die Hand, ehe sie sich in ihre Büros begaben. Nach ein paar Metern blieb L. vor einer Tür stehen. Ein Schild, diesmal jedoch aus Plastik, wies daraufhin, dass hier der Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei sitzt.
Obermeister L. kramte ein riesiges Schlüsselbund aus der Tasche seiner Uniformhose und schloss die Tür auf. Da lag es nun endlich vor mir, mein künftiges Domizil.
Das sich auf dem ersten Blick nicht wesentlich von anderen Dienstzimmern der Volkspolizei unterschied:
Von der Wand lächelte auch hier das Portraitfoto Erich Honeckers den Eintretenden an. Schreibtisch, Telefon, Schreibmaschine, ein langer mit rotgepolsterten Stühlen umstandener Tisch und ein paar Schränke vervollständigten das Bild. Und doch gab es einen gewaltigen Unterschied zu allen anderen, mir seit längerem bekannten Dienstzimmern: dieser Raum würde mir allein gehören! So glaubte ich jedenfalls.
L. strahlte eine stoische Ruhe aus. Quasi das lebende Gegenstück zu einem Heißsporn wie mir. Dass diese Ruhe, Ausdruck von Gelassenheit und Lebenserfahrung, die beste Basis für einen erfolgreichen ABV darstellte, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dazu brauchte es erst einiger nachhaltiger „Aha-Erlebnisse“.
Gleich zum Anfang befreite mich Obermeister L. von etlichen Illusionen. So erfuhr ich, dass ein Abschnittsbevollmächtigter bei Bekanntwerden einer Straftat nicht etwa sofort eine Strafanzeige aufnehmen und ermitteln durfte. Die Geschäftsordnung sah vor, dass man zunächst die Kriminalpolizei zu informieren hatte. In aller Regel Oberleutnant Peter V.. Dieser entschied dann, wer in der Angelegenheit tätig wird. Schwerere Fälle wurden generell von der Kriminalpolizei bearbeitet. Dazu gehörte auch die Aufnahme der Strafanzeige. Der Abschnittsbevollmächtigte durfte ohne Erlaubnis und Absprache mit der Kripo, nicht einmal einen Vordruck in die Schreibmaschine spannen, klärte mich der Obermeister auf.
L. dämpfte auch meine Erwartungen an „spannende Bereitschaftsdienste“. Bislang hatte er es lediglich dreimal erlebt, während der Bereitschaft zum Einsatz gerufen zu werden.
Zur Sicherstellung einer ständigen Erreichbarkeit, auch außerhalb des Dienstzimmers, hatte man die „Dorfsheriffs“ mit Funkgeräten ausgerüstet. Für einen gegenseitigen Funkverkehr, im herkömmlichen Sinn, waren die auf dem ersten Blick den damals weit verbreiteten „STERN-Rekordern“ ähnelnden Geräte jedoch nicht geeignet. Funksprüche konnten damit zwar empfangen, jedoch nicht gesendet werden. Im Ernstfall taugte der sperrige Kasten höchstens als Wurfgerät.
Da ich in meiner Privatwohnung keinen Telefonanschluss besaß, würde das Funkgerät wohl demnächst einen Ehrenplatz neben meinem Bett bekommen. Ärger mit meiner zu diesem Zeitpunkt hochschwangeren Ehefrau war somit vorprogrammiert!
In den kommenden Tagen sollte ich nicht nur den Abschnitt selbst, sondern vor allem die wichtigsten lokalen Entscheidungsträger kennen lernen. Neben den Bürgermeistern waren das der Vorsitzende der LPG Dolgelin, Werner Ro. und der „Betriebsteilleiter Sachsendorf“ der LPG Golzow, Klitzke. Sohn des legendären, unter anderem durch die „Kinder von Golzow“ weit über die Grenzen des Oderbruchs bekannten sozialistischen Agrarpioniers Artur Klitzke.
Der Abschnitt Dolgelin bestand, wie bereits erwähnt, aus den Dörfern Dolgelin, Libbenichen, Carzig, Alt Mahlisch, Neu Mahlisch, Friedersdorf und Sachsendorf (inklusive des Ortsteils Werder). Sachsendorf war erst 1988 dazu gekommen. Nach der Berentung des langjährigen, in der Bevölkerung äußerst beliebten, zuständigen ABV. Hauptmann der VP Alois Fleischer. Da der für Dolgelin und Umgebung zuständige Oberleutnant der VP Rudi Kü., sehr oft krankheitsbedingt ausfiel, musste Alois ohnehin ständig dessen Vertretung übernehmen. Was lag also näher, als beide Abschnitte zusammenzulegen?
Alois gehörte nicht zu denen, die einfach die Hände in den Schoß legen konnten. Noch immer fühlte er sich für die Ordnung und Sicherheit in seinem Wohnort verantwortlich. Für den Posten eines Zugführers im VP-Helferkollektiv Sachsendorf konnte es keinen besseren geben. Alois, den Einwohner Sachsendorfs bei bestimmten Problemen weiterhin als Ansprechpartner ansahen, empfand diesen Posten keineswegs als Herabsetzung. Alois Fleischer erwies sich für mich als absoluter Glücksfall. Mehr als einmal konnte ich von seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz profitieren. Leider fand unsere Zusammenarbeit bereits nach wenigen Monaten ein tragisches Ende. Alois, den die täglichen Enthüllungen über Privilegien und Verbrechen der SED-Nomenklatura sehr aufregten, erlitt Ende November 1989 einen schweren Schlaganfall. An dessen Folgen er noch am selben Tag verstarb. Alois wurde an einem nasskalten Dezembertag, unter militärischen Ehren, auf dem Friedhof in Sachsendorf beigesetzt. Zum letzten Mal in der Geschichte des VPKA Seelow hallten Salutschüsse für einen verstorbenen Mitarbeiter über einen Friedhof. Eine „Ehre“, auf die Alois sicher gerne verzichtet hätte..
Eines Tages, unmittelbar vor der offiziellen Dienstübergabe, bekamen wir es endlich mit einem richtigen Kriminalfall zu tun:
Kleinlaut beklagte sich der Dolgeliner LPG-Vorsitzende, dass aus einem zur LPG gehörendem Viehstall in Alt Mahlisch ein Bullenkalb verschwunden war. Einen Unglücksfall schloss der Vorsitzende aus. Der Verdacht lag nahe, dass das Tier in einem privaten Stall zwecks späteren gewinnbringenden Verkaufes gemästet werden sollte. In der DDR gab es auf dem platten Land kaum jemand, der sich kein Nutzvieh hielt. Rinder, Schweine, Hühner. Deren Verkauf nicht selten mehr einbrachte, als der offizielle Verdienst. Dazu kam noch der Erlös aus dem Anbau von Gurken und / oder Tomaten. Der den Bewohnern des Oderlandes bescheidenen Wohlstand garantierte.
Obermeister L., der nichts mehr hasste als „blinden Alarm“, entschied sich, die Kriminalpolizei zunächst noch nicht in Kenntnis zu setzen. Das Tier konnte konnte schließlich in irgendein Loch gefallen und verendet sein.
Zuerst fuhren wir nach Alt Mahlisch. Die Mitarbeiter des Viehkomplexes gaben sich ahnungslos. Zuckten die Achseln und hüllten sich mehr oder weniger in absolutes Schweigen.
„Vielleicht ist das Vieh ja in eine Jauchegrube gefallen?“, murmelte ein den Stallgang fegender LPG-Bauer.
„Dann würde der Kadaver doch herausschauen“, wandte eine Bäuerin ein.
„Meinst du etwa, dass jemand das Kalb gestohlen haben könnte?“ „Blödsinn!“, erwiderte die Bäuerin im Brustton der Überzeugung.
„Aber irgendwo muss das Tier doch abgeblieben sein“, schimpfte L. ungehalten.
Wortlos gingen die Bauern ihrer weiteren Arbeit nach. Wir stießen auf eine Mauer des Schweigens.
Bei der Begehung des Außenbereiches, stießen wir auf einen äußerst interessante Fährte:
Von der Futterkammer führte, durch das überall wuchernde Unkraut, ein breiter Trampelpfad. Dieser endete zunächst an dem schadhaften, verrosteten Maschendrahtzaun. Hinter dem, an dieser Stelle heruntergedrückten Zaun, führte der Pfad weiter in Richtung des nahen Dorfes. Überall auf dem Pfad kündeten verloren gegangene Futterreste von einer intensiven Nutzung des Weges.
Das halbe, wenn nicht sogar das gesamte Dorf, bediente sich offenbar aus der Futterkammer der LPG Dolgelin!
L. verlor für einen Augenblick seine geradezu charakteristische Ruhe:
„Das ist eine Nummer zu groß für uns! Am besten, wir fahren sofort ins VPKA und reden mit Peter V. darüber.“
Zehn Minuten später trafen wir in Seelow ein. Leider trafen wir Oberleutnant V. nicht in seinem Dienstzimmer an.
„Peter ist drüben, beim K-Leiter. Der Kreisstaatsanwalt ist auch da“, erfuhren wir von einem anderen Kriminalisten.
„Da haben wir ja alle wichtigen Leute beisammen“, meinte L.. Der es trotzdem vorgezogen
hätte, zunächst unter vier Augen mit Peter V. zu reden.
Entschlossen begaben wir uns in „die Höhle des Löwen“. Dem Dienstzimmer von Hauptmann der K Dietrich S.. Dem K-Leiter des Volkspolizeikreisamtes Seelow.
S., ein mit schütterem Haupthaar gesegneter Endvierziger, zeigte sich ungehalten über das unangekündigte Erscheinen. Wir hatten ihn offenbar bei einer wichtigen Unterredung gestört.
Ohne Umschweife schilderte Obermeister L. den Grund der Störung. Der Kreisstaatsanwalt rückte sich den Schlips zurück. Der hagere Jurist mit den Gesichtszügen eines chronisch Magenkranken gehörte zu den unbeliebtesten Persönlichkeiten im Landkreis.
L.s Bericht ließ das Antlitz des Anklagevertreters noch mehr erstarren. Kein Wunder! Hatten wir doch soeben einen eklatanten Fall von Diebstahl von „sozialistischem Eigentum“, ermöglicht durch unvorstellbare Schlamperei, aufgedeckt.
Kreisstaatsanwalt und K-Leiter wechselten ständig säuerlich anmutende Blicke mit einander.
„Was sollen wir in der Angelegenheit weiter unternehmen?“, erkundigte sich L..
„Nichts“, antwortete der Kreisstaatsanwalt überraschend bissig. „Absolut nichts! Ich werde das persönlich mit dem LPG-Vorsitzenden klären.
Das für uns verstehen:
Es hat keine Diebstähle gegeben! Weder den eines Kalbes, noch den von Futtermitteln! Ich verbiete euch, weitere Ermittlungen anzustellen!“
Tief enttäuscht, hofften wir auf Oberleutnant V.‘s Unterstützung. Aber selbst der Starermittler der Seelower Volkspolizei wagte dem Kreisstaatsanwalt nicht zu widersprechen.
„Was steht ihr hier noch herum? Schert euch raus auf Streife“, blaffte der K-Leiter, wie in einem schlechten Film.
Statt als umsichtige Volkspolizisten gelobt zu werden, hatte man uns kurzerhand wie schnöde Bittsteller abserviert.
Den Grund, so simpel wie erschreckend:
Die LPG Dolgelin gehörte zu den Vorzeigebetrieben im Kreis Seelow. Polizeiliche Ermittlungen wegen möglicherweise über einen längeren Zeitraum wiederholt verübten Diebstahlsdelikten wären der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben. Was wiederum die SED-Kreisleitung auf den Plan gerufen hätte. Um unnötigen Ärger zu vermeiden, zog es der Kreisstaatsanwalt vor, die Angelegenheit „dezent zu behandeln“. Heute würde man dazu wohl „Strafvereitelung im Amt“ sagen!
Am Nachmittag übergab mir Obermeister L. offiziell die Führung der Dienstgeschäfte.
ABV durfte ich mich, offiziell, trotzdem nicht nennen. Ich blieb nach wie vor Schutzpolizist! Wenn auch ein „Schutzpolizist im Abschnitt“. Was der Bevölkerung aus begreiflichen Gründen völlig egal sein konnte. Für die Bevölkerung war ich vom ersten Tag an nichts anderes als der neue Abschnittsbevollmächtigte.
Ein wichtiges Ereignis fehlt jedoch noch in der Aufzählung:
Am 20. August 1989 wurde mein Sohn Sascha geboren. Völlig überraschend, sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Und wo hielt sich der stolze, nichtsahnende Vater zu diesem Zeitpunkt auf? Natürlich im Dienst! Für die Welt noch viel zu mager, verbrachte mein Sohn die ersten Lebenstage in einem Brutkasten. Liebevoll umsorgt von den Ärzten und Schwestern im Bezirkskrankenhaus Frankfurt (Oder)-Markendorf. Mittlerweile sieht man ihm den Zwischenaufenthalt nicht mehr an. Aus dem „Früchtchen“ ist längst ein fast 1,90 m großer, junger Kerl geworden
c) September bis Dezember
Aller Anfang ist schwer
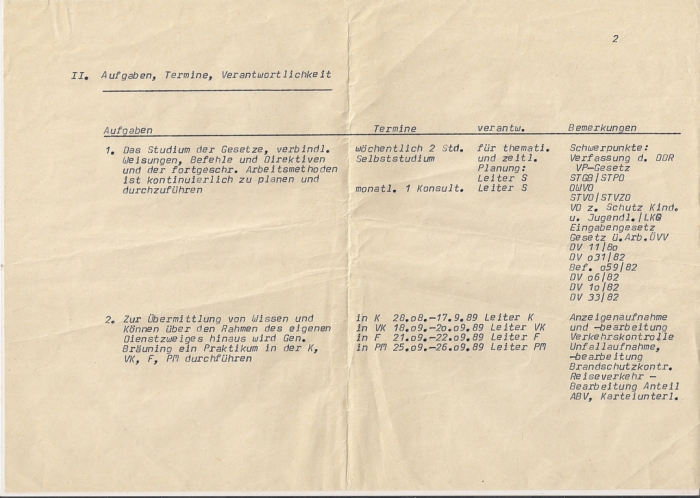
Übereifrig stürzte ich mich in die Herausforderung. Endlich „gehörte“ mir der Abschnitt allein. Zunächst jedoch musste ich eine Woche lang nach Potsdam. Zum ersten Durchgang des Vorbereitungsstudiums. Dort trafen zahlreiche „ABV-Anwärter“ aus allen Bezirken der DDR aufeinander.
Ein Thema beherrschte die Gespräche an der Polizeischule: die immer mehr anschwellende Ausreisewelle aus der DDR.
Selbst die Lehrer, allesamt gestandene Offiziere, sahen sich nicht in der Lage, darauf eine befriedigende Antwort zu geben.
Wohltuenderweise flüchteten sie jedoch nicht in die üblichen Phrasen „vom bösen, die Menschen aus der DDR fortlockendem Klassenfeind“.
Dass die Hauptursache der Fluchtwelle in unserem Land, vor allem jedoch in der Politik der herrschenden SED lag, durfte der Lehrkörper an der Polizeischule Potsdam freilich noch nicht offen äußern.
Ich selbst stand der „Abstimmung mit den Füßen“ zu diesem Zeitpunkt noch ablehnend gegenüber. Wie oft hatte ich in diesen Tagen kopfschüttelnd vor dem Fernseher gesessen und mir die Interviews mit DDR-Bürgern, welche in den Botschaften der Bundesrepublik in der CSSR oder Ungarn Zuflucht suchten, angesehen.
„Du wirst sehen, die kommen alle wieder zurück. Spätestens, wenn die drüben keine Arbeit finden, werden sie ihren Schritt noch bitter bereuen“, hatte ich meiner Frau mehr als einmal prophezeit.
In meinem blinden Eifer trat ich in jedes sich bietende Fettnäpfchen. Wobei ich unter anderem zwischen die Fronten eines seit Jahren ausgefochtenen Streits zweier in Libbenichen lebender Familien geriet. Dummerweise gelang es mir nicht immer, den Eindruck der absoluten Unparteilichkeit aufrechtzuhalten. Außerdem sicherte ich einer der Familien zu, dass ich jederzeit für sie da wäre.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass man das leichtsinnig gegebene Versprechen wörtlich nehmen würde. Beinahe jeden zweiten Abend, meist nach 21:00 Uhr, schickte mich der „Operative Diensthabende“ nach Libbenichen. Zum Streit schlichten.
„Hast du denen wirklich gesagt, dass sie sich nicht scheuen sollten, nach dem ABV zu verlangen. Selbst mitten in der Nacht?“, fragte der Diensthabende ungläubig. „Ja, äh, aber so hatte ich das nicht gemeint“, räumte ich verlegen ein. „Dann sieh gefälligst zu, wie du aus der Sache herauskommst“, lautete die knappe Antwort des Diensthabenden.
Hauptmann B. erlöste mich schließlich aus der misslichen Lage. Kurzerhand bestellte er die Streithähne zu einer freundschaftlichen Aussprache in den „Rat der Gemeinde“. Eine Stunde dauerte das Gespräch. An dessen Ende sich die „verfeindeten“ Parteien versöhnlich die Hände schüttelten.
B. schlug mir anschließend lachend auf die Schulter. „So macht man das! Das lernst du auch noch. Aller Anfang ist eben schwer.“
Den nächsten Unmut handelte ich mir ein, als ich jedem kleinsten Hinweis auf vermeintlich strafbare Handlungen sofort in einer Art und Weise nachging, als ob man mir tatsächlich ein Verbrechen gemeldet hätte. Oberleutnant der K Peter V. hatte kaum noch eine ruhige Minute. Weil ich ihm ständig neue Straftaten meldete, die sich jedoch bei näherer Betrachtung als gewöhnlicher Dorftratsch herausstellten.
Mein besonderes Augenmerk galt der Verkehrssicherheit. Wie nicht anders zu erwarten, schoss ich auch in dieser Hinsicht zunächst mehrfach über das angestrebte Ziel hinaus. Was bei einem Schutz- oder Verkehrspolizisten als straffe Dienstdurchführung galt, konnte einem Abschnittsbevollmächtigten eine Menge Ärger einbringen.
Bei einem Streifengang, während des Erntefestes, wollte mir eines meiner „Opfer“, stark alkoholisiert, „an die Wäsche gehen“. Nur dem Einschreiten anderer Gäste war es zu verdanken, dass es bei dem verbalen Angriff blieb. Gegen den mir körperlich weit überlegenen Wüterich hätte ich nicht die Spur einer Chance gehabt. Wie ein Sparringboxer KO zu gehen, fördert nicht gerade das Ansehen. Da ich mich an dem Wutausbruch nicht ganz unschuldig fühlte, beschloss ich die Attacke einfach zu ignorieren. Leider konnte die Bürgermeisterin den Mund nicht halten. Hauptmann B. erfuhr von dem Vorfall. Ich bemühte mich nach Kräften, die für mich in jeder Hinsicht peinliche Angelegenheit abzuwiegeln. Mein Vorgesetzter bestand jedoch auf der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens gegen den Betreffenden, der am Ende um fünfundsiebzig Mark ärmer war. Er konnte sich bei den anderen auf dem Fest anwesenden Einwohnern bedanken, sonst hätte die Sache für ihn durchaus teurer enden können.
Als „einfacher“ Schutzpolizist hatte ich stets von spannenden Ermittlungen geträumt. Mit Ermittlungsaufträgen bekam ich es tatsächlich in Hülle und Fülle zu tun. Diese richteten sich jedoch nicht gegen Straftäter, sondern gegen Personen welche in den „Westen“ reisen wollten. Ich bekam meine Ermittlungsaufträge also nicht von der Kriminalpolizei sondern von der Abteilung „ Pass & Meldewesen“.
Dort interessierte man sich, neben der Einstellung zur Politik der SED, besonders für die Besitzverhältnisse und das familiäre Umfeld des Reiselustigen.
Frei nach dem Motto:
Wer sich in der DDR etwas geschaffen hat, kommt anschließend wieder nach Hause zurück!
Falls überhaupt, durfte ohnehin lediglich ein einziges Familienmitglied die Reise gen Westen antreten.
Während der Rest, sozusagen als „Geiseln“ zurückblieb.
Wer gibt schon eine intakte Familie auf, um sich in der Bundesrepublik ein neues Leben aufzubauen. Auf solchen Überlegungen basierten die „Ermittlungsaufträge“ der Abteilung „Pass & Meldewesen“.
Hauptmann B. hatte dazu unmissverständlich mir gegenüber Position bezogen:
„Wir legen niemandem Steine in den Weg! Die Menschen wollen nur eines: ihre Verwandten besuchen. Der Ermittlungsbericht ist so positiv wie möglich abzufassen.“
Bei der Einschätzung der politischen Haltung sollte durchgehend der Standartsatz „XY verhält sich zur Politik der SED loyal“, verwendet werden.
O-Ton Hauptmann B.:
„Wer meckert, ist noch lange kein Staatsfeind! Meckern tuen wir alle mal. Außerdem sind die wahren Staatsfeinde alle bekannt. Von denen darf sowieso keiner in den Westen reisen.“
Wobei es sich dabei nicht zwingend um, im Sinn der DDR, „negative Mitbürger“ handeln musste. Ebenso wurden regelmäßig Reiseanträge von so genannten „Geheimnisträgern“, mithin also „fortschrittlichen Staatsbürgern“, ablehnend beschieden. Warum? Weil die chronisch misstrauische Staatssicherheit das Risiko nicht eingehen wollte, dass der oder die jenige das anvertraute „Geheimwissen“, gegenüber dem „Klassenfeind“ offenbarte.
In den Genuss einer „Westreise“, vor dem Eintritt des Rentenalters, kam in der Regel also nur, wer weder zu positiv oder zu negativ aus der grauen Masse hervorragte. Von diversen Künstlern und ähnlichen „VIP“ einmal abgesehen.
Mich würde interessieren, wie unsere Enkel und Urenkel eines Tages über diesen Unfug denken. Wahrscheinlich werden sie voller Unverständnis die Köpfe schütteln oder einfach darüber lachen. Ich hoffe inständig, im Interesse nachfolgender Generationen, dass so etwas niemals erleben müssen!
„Auftrag Geheim“
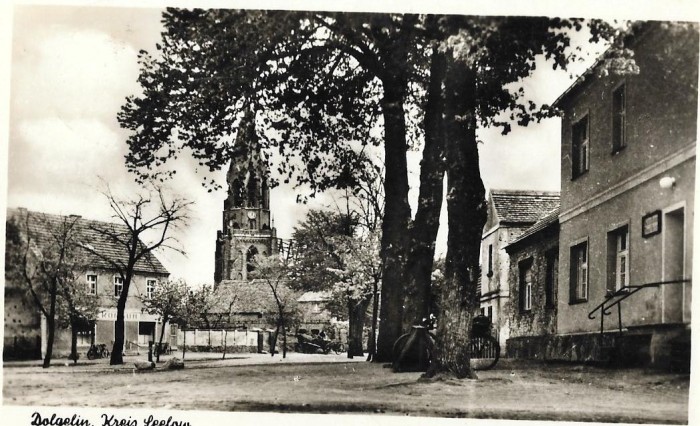
Anfang September ging ein Gespenst im Kreis Seelow um. Das Gespenst geisterte durch sämtliche Partei und Dienstversammlungen des Volkspolizeikreisamtes und wurde „Neues Forum“ genannt. Hinter dem unverfänglichen Namen verbarg sich, laut Parteisekretär und Amtsleitung, eine Art antisozialistischer Plattform. Ein Sammelbecken für gewalttätige, zum Umsturz bereitete reaktionäre Staatsfeinde. Gesteuert und angeleitet vom „Klassenfeind“. Von wem auch sonst?
Der Ton in den nun mindestens einmal in der Woche abgehaltenen Versammlungen verschärfte sich zusehends:
„Der Gegner ist momentan dabei, eine Kampagne gegen die sozialistischen Staaten zu starten. Wobei er sich insbesondere auf unsere Republik eingeschossen hat. Sind ihm doch die in nun mehr vierzig Jahren erreichten Errungenschaften der DDR, ein Dorn im Auge. Allen Bemühungen zum Trotz, es wird dem Gegner nicht gelingen, diese Entwicklungen rückgängig zu machen“, verkündete kämpferisch der Leiter der Abteilung „Pass & Meldewesen“, Hauptmann Heinz H. vor der versammelten Belegschaft des VPKA Seelow.
Andere Offiziere bemängelnden die ungenügende Parteiarbeit in einigen Betrieben und Einrichtungen des Kreises. Wobei die Konsum-Kaufhalle in der Seelower Straße der Jugend, als besonderes Beispiel angeführt wurde:
„Dort wurde bereits seit Monaten keine Parteiversammlung mehr durchgeführt“, wusste ein Polizist, dessen Frau in eben dieser Kaufhalle arbeitete, zu berichten. „Wir dürfen doch dem Gegner nicht das Feld überlassen!“
Leidenschaftliche Worte, die leider meilenweit an der Realität vorbeigingen.
Tag für Tag verließen die Einwohner einer kompletten Kleinstadt die DDR. Aus den verschiedensten Gründen. Ganz sicher jedoch nicht wegen der „mangelnden Präsenz der SED“. Die wahren Ursachen lagen ganz woanders. Wie immer jedoch, wagte niemand den Finger in die Wunde zu legen. Noch nicht!
Um den Massenexodus zu stoppen, verlegte man sich stattdessen auf obskure Propagandaaktionen. Wie die folgenden Zeilen zeigen:
Eines Vormittags erreichte mich ein Anruf von Hauptmann Werner Thie., dem an Stelle des sich im Urlaub befindlichen Hauptmann B., die Leitung des – Gruppenpostens Süd- oblag:
„Gegen 13:00 Uhr kommt der Genosse O. von der Kreisdienststelle zu dir nach Dolgelin.
Der Genosse möchte mit dir eine Aktion besprechen.“
Der Gedanke, einen MfS-Mitarbeiter zu empfangen, löste bei mir durchaus ambivalente Gefühle aus. Einerseits fühlte ich mich geschmeichelt, dass ausgerechnet jemand von der Staatssicherheit eine Aktion mit mir besprechen möchte. Andererseits herrschte zwischen Volkspolizei und Staatssicherheit ein mehr oder weniger distanziertes Verhältnis.
Wobei man keineswegs unfreundlich miteinander umging. Einige der operativen Mitarbeiter der Kreisdienststelle, gingen ohnehin täglich im VPKA ein und aus.
Diese Distanz begründete sich vielmehr auf die geheimnisvolle, latent bedrohliche Aura, die vom MfS unwillkürlich ausging. Kaum jemand wusste, was hinter den vergitterten Fenstern der am ehemaligen Kleinbahnhof gelegenen Kreisdienststelle für Staatssicherheit tatsächlich vor sich ging. Keine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der „Schutz und Sicherheitsorgane“. Eines wusste jedoch jeder: die reserviert netten Genossen konnten, im Fall des Falles, der eigenen beruflichen Karriere ein jähes Ende setzen.
In dienstlicher Hinsicht gehörten die Abschnittsbevollmächtigten der VP, zu den ersten bevorzugten Kontaktpersonen der Staatssicherheit. Wer sonst kannte das Territorium und dessen Einwohner besser als ein langjähriger „Dorfsheriff“? Außerdem konnten sich die Stasimitarbeiter darauf verlassen, dass die vom ABV gelieferten Informationen der Wahrheit entsprachen. Und nicht etwa durch persönliche Aversionen getrübt waren. Ausnahmen mögen auch hier die Regel bestätigen.
Wer jetzt empört die Backen über die „Kumpanei“ zwischen ABV und Stasi aufbläst, dem sei gesagt:
Kein ABV konnte sich, ohne erhebliche dienstrechtliche Konsequenzen, der Kooperation mit dem MfS entziehen! Außerdem gibt es auch Beispiele dafür, dass Abschnittsbevollmächtigte auf Grund der abgelieferten Einschätzung vorschnell geäußerte Verdachtsmomente gegen Einwohner ihres Abschnittes bereits im Vorfeld entkräften konnte.
Um 13:00 Uhr klopfte es wie erwartet an der Tür meines Büros in Dolgelin. Der Genosse O. entsprach weder vom Äußeren noch vom Auftreten her dem typischen Klischee eines Stasimitarbeiters. Dem schlanken, ruhig und überlegt auftretenden Mittvierziger sah man noch immer den ehemaligen Lehrer an. Warum er Klassenzimmer und Schülerschar gegen die vergitterte Atmosphäre der MfS-Kreisdienststelle eintauschte, wird wohl nur er selbst erklären können.
Mit einer knappen Handbewegung bot ich meinem Besucher einen Stuhl an.
O. sah mich überrascht an, möglicherweise hatte er meinen Vorgänger erwartet.
„Wie lange bist du denn schon ABV hier? Ist das nicht der Abschnitt vom Genossen L.?“ Das waren gleich zwei Fragen auf einmal. „Genosse L. absolviert gerade den einjährigen Lehrgang an der ABV-Schule. Ich vertrete ihn nur.“
O. nickte. Dankbar nahm er den angebotenen Kaffee an. Nebenbei erkundigte er sich, ob mir der Dienst hier gefällt. Junge komm auf den Punkt, dachte ich, deswegen bist du doch nicht hier!
O.setzte die Tasse ab, räusperte sich kurz um dann endlich die berühmte Katze aus dem Sack zu lassen:
„Ich muss dir ja sicher nicht erklären, vor welchen Problemen die DDR zurzeit steht. Zum Beispiel, dass täglich tausende Bürger die Republik verlassen. Pass auf, ich mache es kurz:
In deinem Abschnitt, genauergesagt in Sachsendorf, lebt eine Familie U. Der Bruder von Frau U. gehört zu den ersten, die über Ungarn abgehauen sind. Momentan befindet er sich in einem Übergangsheim in der Bundesrepublik. Wir haben erfahren, dass es ihm dort gar nicht gefällt. Er leidet unter starkem Heimweh und unter der Trennung von seiner Familie. Es ist geplant, an die Frau U. heranzutreten und sie zu bitten, ihren Bruder von der Rückkehr in die DDR zu überzeugen. Deine Aufgabe besteht darin, die Frau U. unter einem Vorwand für morgen früh 08:00 Uhr in dein Dienstzimmer zu bestellen. Ich werde dann ebenfalls anwesend sein. Um die Frau nicht von Anfang an zu erschrecken, soll es zunächst so aussehen, dass sie vom zuständigen Abschnittsbevollmächtigten und nicht von dem MfS vorgeladen wurde.
Sobald Frau U. eintritt, wirst du das Zimmer verlassen. Und nicht vor dem Mittagessen dorthin zurückkehren. Vorher übergibst du mir die Schlüssel. Ich werde sie dann, im Anschluss bei der Sekretärin des LPG-Vorsitzenden hinterlegen.“
O. hatte betont langsam und deutlich gesprochen. Wie ein Lehrer mit einem etwas begriffsstutzigen Schüler. Die Aussicht, an einem „Propagandacoup“ mitzuwirken, schmeichelte meinem Selbstgefühl als frisch gebackener ABV. Das ich dabei lediglich die Drecksarbeiten zu leisten hatte und eine undankbare Komparsenrolle spielte, wurde mir vor zunächst nicht bewusst.
Ein wenig ärgerte ich mich darüber, vom Genossen O.. quasi des eigenen Dienstzimmers verwiesen zu werden. Über eine Weisung der Staatssicherheit durfte zwar heimlich geschmollt, jedoch nicht offen gemosert werden. Es wurde als ebenso unabänderlich wie der tägliche Sonnenaufgang angesehen. Was ich heute, im Abstand vieler Jahre, selbst nicht mehr verstehen kann.
„Dann wollen wir mal hoffen, dass die Aktion erfolgreich verläuft“, sagte ich bemüht optimistisch.
O. zuckte skeptisch mit den Schultern. So richtig überzeugt schien er von dem Vorhaben wohl nicht zu sein. Das konnte man seinem Gesichtsausdruck deutlich ansehen:
„Alles hängt von der Bereitschaft der Frau U. ab. Zwingen können wir sie jedenfalls nicht.“
Nachdem er den letzten Schluck genommen hatte, verabschiedete sich O. schon wieder: „Ich verlass mich auf dich. Rufe bitte in der Kreisdienststelle an und sage Bescheid ob es mit der Vorladung der Frau U. geklappt hat.“
O. legte den rechten Zeigefinger quer über den Mund:
„Erzähle bitte niemanden von dem Vorhaben! Der Auftrag an die Kreisdienststelle kam von ganz oben. Sollte die Sache platzen, nur weil jemand den Mund nicht halten konnte, dürfte das für denjenigen nicht ohne Folgen bleiben.“
Der letzten Satz klang nicht nur wie eine Drohung, er war auch als Drohung gedacht!
„Also, bis morgen früh um acht“, sagte O.. und verschwand durch die Tür. Ich atmete auf. Um jemanden ohne konkrete Angabe des Grundes vorzuladen, bedurfte es in der DDR keiner allzu großen Kreativiät. Unter der Floskel „zur Klärung eines Sachverhaltes“ konnte sich so gut wie alles verbergen. Von einer harmlosen Befragung bis hin zur Beschuldigtenvernehmung. Schwieriger wurde es jedoch, wenn mich Frau U. direkt anspricht. Werde ich ihr ins Gesicht lügen können? Wie stehe ich denn da? Ein ABV, der jemanden vorlädt, ohne zu wissen warum?
Beim Abwaschen der Tassen grübelte ich über den ungewöhnlichen Auftrag nach. Je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger gefiel er mir.
Genaugenommen hatte mich O.. soeben zum Mitwisser eines staatlich sanktionierten Betruges gemacht. Ein heimwehkranker Flüchtling sollte von der eigenen Schwester, unter Zusicherung von Straffreiheit, zur Rückkehr bewegt werden. Was durchaus noch als „noble Geste“ durchgehen konnte. Nicht in Ordnung fand ich jedoch, dass der „reuige Sünder“ für den Gegenwert einer Neubauwohnung aus dem MfS-Kontingent Horrorgeschichten unters Volk streuen sollte. Warf man solche unfairen Methoden nicht dem Westen immer vor?
Mir blieb nichts anderes übrig, als die Karte auszufüllen. Ich versuchte mir einzureden, dass momentan ein heftiger Propagandakrieg tobt und die Aktion somit als eine Art „Kriegslist“ anzusehen.
Obwohl es erst früher Nachmittag war, traf ich Frau U. in ihrem Eigenheim, einem typischen Fünfziger-Jahre- Bau, an. Mehr erstaunt als erschrocken, schaute sie auf die Vorladungskarte.
„Habe ich etwas angestellt?“, fragte die Frau. Wobei sie mich schüchtern anlächelte. Ich lächelte, nicht minder schüchtern, zurück. „Das glaube ich nicht.“ „Sie glauben es nicht? Sie müssen es doch wissen!“
Genau das hatte ich befürchtet! „Ich weiß wirklich nicht, worum es geht. Ich habe nur den Auftrag, ihnen die Vorladung zu übergeben.“
Frau U. fuhr der Schreck sichtlich in die Glieder.
„Aber es ist ganz sicher nichts schlimmes“, fügte ich deshalb beschwichtigend hinzu.
„Sie können doch zur angegebenen Zeit bei mir im Dienstzimmer erscheinen?“, vergewisserte ich mich. „Ja, ja, schon. Ich habe Urlaub“, stammelte Frau U..
Ich fühlte mich wie der letzte Depp. Nichts wie weg!
Zurück im Büro, wählte ich die öffentliche Telefonnummer der Kreisdienststelle:
„Kreisdienststelle Seelow des Ministeriums für Staatssicherheit“ sagte eine junge Männerstimme am anderen Ende der Leitung. „Hauptwachtmeister Bräuning, der ABV von Dolgelin. Bitte teilen Sie dem Genossen O. mit, dass alles geklappt hat.“
Der Telefonist stellte keine weiteren Fragen. „Ist in Ordnung, Genosse Bräuning. Ich werde es ihm ausrichten“, versprach er wohlwollend.
Am nächsten Morgen traf ich mich kurz vor 08:00 Uhr, wie vorgesehen, mit dem Genossen O. in meinem Dienstzimmer. Viel Zeit für eine Unterhaltung blieb nicht. Frau U. erschien wenige Minuten vor der angegebenen Zeit. Der Stasi-Mann begrüßte sie, während er mich im selben Atemzug meines eigenen Büros verwies. Vier Stunden später kehrte ich dorthin zurück. Zuerst holte ich die Schlüssel von der Sekretärin ab. Wortlos übergab sie mir das Schlüsselbund. Ich war wieder Herr über mein Büro!
Um es vorwegzunehmen: Ich habe nie mehr etwas von der obskuren Aktion gehört. Ganz gleich ob sich Frau U. nun auf das „unmoralische Angebot“ der Seelower Stasi einließ oder nicht, die dramatischen Ereignisse der kommenden Wochen und Monate dürften solche oder ähnliche Vorhaben bereits im Keim erstickt haben.
An die Grenze!

Um den 20. September herum geriet auch das VPKA Seelow in den Strudel der Wendeereignisse. Die stetig steigende Fluchtwelle aus der DDR, nahm ihren Weg nicht mehr allein über die Grenze zur CSSR. Sondern seit kurzem auch über die Oder und Neiße hinein ins benachbarte Polen.
In einer eilends einberufenden Dienstversammlung im Schulungsraum des VPKA erfuhren die Abschnittsbevollmächtigten des Kreises Seelow aus dem Mund des Amtsleiters, Oberstleutnant der VP N., welche Brisanz die Lage an der Staatsgrenze zur Republik Polen mittlerweile angenommen hatte.
Vierzig Kilometer davon gehörten zum Verantwortungsbereich des VPKA Seelow. Für den Schutz dieser Staatsgrenze waren naturgemäß die Grenztruppen der DDR verantwortlich.
Diese zeigten sich jedoch, sowohl personell noch technisch nicht in der Lage, die entstandene Situation in den Griff zu bekommen.
Am Vormittag hatte der Operativoffizier des Volkspolizeikreisamtes Seelow gemeinsam mit dem zuständigen Unterabschnittskommandeur der Grenztruppen über gemeinsame Maßnahmen an der Staatsgrenze zu Polen beraten.
Fürs erste sollte die Volkspolizei an besonders gefährdeten Bereichen Präsenz zeigen.
„Angriffe auf die Staatsgrenze“ wurden immer dort befürchtet, wo eine Straße direkt an die Oder führte. Beispielsweise in Kienitz, Sophiental, Kietz und Reitwein.
Vor allem jedoch zwischen Lebus und dem nördlichen Stadtrand von Frankfurt (Oder). Im Bereich der vielbefahrenen Fernverkehrsstraße 112. Gerade dort war es tatsächlich in den vergangenen Tagen und Nächten zu mehreren Festnahmen gekommen.
Die Kapazität der Gewahrsamszellen reichte kaum aus, um die Festgenommenen bis zur Vernehmung durch die Kriminalpolizei und der weiteren Entscheidung durch Staatsanwalt und Gericht unterzubringen. Von nun hatte ständig, rund um die Uhr, mindestens ein Kriminalpolizist in der Dienststelle anwesend zu sein. Vernehmungen fanden in dieser verrückten Zeit regelrecht am Fließband statt. Ständig mussten sich zwei Schutzpolizisten bereithalten, um die Festgenommenen von der Oder ins VPKA zu transportieren. Der Streifenwagen stand zu keinem anderen Zweck mehr zur Verfügung!
Den Abschnittsbevollmächtigten fiel die Aufgabe zu, täglich mehrere Stunden, an einem der genannten „gefährdeten Sektoren“ Streife zu laufen. Zunächst allein oder gemeinsam mit „Freiwilligen Helfern“.
In den kommenden Tagen sollten weitere Kräfte der in Eisenhüttenstadt stationierten „15. VP-Bereitschaft“ zur Unterstützung nach Seelow verlegt und an der Grenze zum Einsatz gebracht werden.
„Ihr handelt ausschließlich im Hinterland der Staatsgrenze“, wies N. an. „Vorn an der Linie handeln die Grenztruppen.“
Linie? Hinterland? Derartige Bezeichnungen kannte ich bislang lediglich aus meinem Wehrdienst, bei den Grenztruppen an der „Berliner Mauer“. Nie hatte ich gehört, dass jemand an der Oder von „Linie“ oder Hinterland gesprochen hätte. Abgesehen davon, dass die „Grenzlinie“ ohnehin in der Mitte des Stroms verlief.
Die dramatische Entwicklung an den bislang ruhigen, relativ bedeutungslosen Grenzen zu Polen und der CSSR hatte den Sicherheitsapparat in eine schwere Sinnkrise gestürzt.
Noch klammerte man sich an den „Strohhalm“, dass die Fluchtbewegung nach dem 07. Oktober abflauen oder gar völlig zum Erliegen kommt. Die verbleibende Zeit bis zu diesem geradezu herbeigesehnten, magischem Datum, konnte notfalls mittels eines erhöhten Kräfteaufwands überbrückt werden. Was aber, wenn sich diese Hoffnung am Ende doch nicht erfüllt?
Oberstleutnant N. brachte es auf den Punkt:
„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Eine Mauer an der Oder kann sich die DDR außenpolitisch einfach nicht leisten!“
Damit sprach der Amtsleiter aus, was viele andere dachten. Ohne einen aufwendigen, pioniertechnischen Ausbau der Ostgrenze wäre der Exodus auf Dauer nicht zu stoppen. Gleichzeitig dürfte aber auch jedem klar sein, dass sich die DDR mit solchen drastischen Maßnahmen politisch endgültig ins Aus schießen würde. Die Republik wäre dann tatsächlich einem Gefängnis gleichgekommen.
Auf solche Gedanken wurde in dieser Versammlung nicht weiter eingegangen.
Stattdessen ging es mit den üblichen markigen Worten weiter. Nach wie vor galt:
Die Fluchtbewegung wurde vom „Gegner“ initiiert. Von falschen Versprechungen und überzogenen Konsumvorstellungen geblendet, gehen ihm leider viel zu viele unserer Menschen auf den Leim.
Die Motivation der gegenwärtigen „gegnerischen Offensive“, wurde im nahenden vierzigsten Jahrestag der DDR gesehen:
Der Gegner schäumt vor Wut, dass es mittlerweile seit vier Jahrzehnten eine sozialistische Alternative auf deutschem Boden gibt. Daher ist ihm jedes Mittel Recht, den verhassten Arbeiter und Bauernstaat zu diskreditieren.
„Im engen Schulterschluss mit den Genossen der Kreisdienststelle für Staatssicherheit werden wir die uns gestellten Aufgaben an der Staatsgrenze erfüllen“, bekundete der Amtsleiter weiter.
Von Anfang an setzte es verbale Seitenhiebe gegen die polnischen Grenzorgane, in die man offensichtlich kein großes Vertrauen setzte.
Schon allein deshalb, weil im Nachbarland die vormals regierende kommunistische Partei, PVAP, sich die Macht mit oppositionellen Kräften teilen musste.
Polen reagierte mit bemerkenswertem Pragmatismus auf den „illegalen Grenztourismus“:
Wen der Grenzschutz unmittelbar beim Übertritt oder zehn Kilometer im Hinterland der Staatsgrenze ertappte, wurde festgenommen und später an die Grenztruppen der DDR übergeben. Außerhalb des „magischen Zehn-Kilometer-Streifens“ stand den Flüchtlingen der weitere Weg nach Warschau in die dortige Botschaft der Bundesrepublik, offen.
Selbstverständlich besaßen die Polen keinerlei Interesse daran, dass an der sensiblen Westgrenze Anarchie aufkam. Anders als in Ost-Berlin hatte man in Warschau jedoch längst begriffen, dass es sich bei der anhaltenden Fluchtwelle um ein reines DDR-Problem handelte.
Polen hatte jedoch noch viel weniger Lust darauf, dass die DDR ihre Probleme auf dem Rücken der polnischen Grenzorgane austrägt. Die vielbeschworene „Gemeinschaft der sozialistischen Bruderstaaten“ zerfiel wie ein Kartenhaus.
.
Zum Schluss verlasen die Gruppenpostenleiter den in Windeseile erstellten Dienstplan, inklusive der zu übernehmenden „Grenzabschnitte“.
Ich wurde in das vier Kilometer von meiner Wohnung entfernten Dorf Kietz beordert. Dort sollte ich zunächst den Abschnitt von der Brücke über den Vorflutkanal, gegenüber der sowjetischen Kaserne, bis hin zum eineinhalb Kilometer entfernten Ortsteil Kuhbrücke bewachen.
Als besonderer Schwerpunkt galt die Eisenbahnbrücke, über die man in wenigen Minuten hinüber nach Polen gelangen konnte.

Zumindest theoretisch. Praktisch musste man zunächst ungesehen an den sowjetischen Posten auf der Oderinsel vorbei. Wobei das Ablaufen der Gleise schon allein ein absolut lebensgefährliches Unterfangen darstellt. Selbst wenn man es ungesehen und mit heilen Knochen über die Brücke schaffte: am anderen Ende wachten rund um die Uhr polnische Grenzsoldaten.
Der Dienstplan sah vor, dass ich bereits unmittelbar nach der Versammlung, von 16:00 Uhr-21:00 Uhr, den Streifendienst im zugewiesenen Abschnitt aufnehme.
Am nächsten Tag hieß es für mich zunächst von 05:00 Uhr-09:00 Uhr Grenzdienst schieben.
Anschließend stand der reguläre Tagesablauf eines Abschnittsbevollmächtigten auf dem Plan. Bis sich am Nachmittag das ganze Spiel wiederholte.
Zwanzig Kilometer lagen zwischen der Oder und meinem Dienstzimmer in Dolgelin. Uns standen kräftezehrende Tage bevor.
Zur Motivation informierte man uns noch, dass angebliche „mehrere hundert Ausreisewillige“ unterwegs sind, die an einem bisher nicht bekannten Ort die Staatsgrenze nach Polen geschlossen überwinden wollen. Eine Entwicklung wie diese hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten.
Hin und her gerissen zwischen Sorge und trotziger Euphorie, trat ich meinen ersten „Grenzdienst“ an der Oder an.
Nach dem Ende der Versammlung fuhr ich zunächst nach Hause. Während ich mir ein Brot rasch noch ein Brot schmierte, bereitete ich meine Frau schonend auf die alles andere als familienfreundliche Lageveränderung vor.
„Du wirst sehen, nach dem siebenten Oktober läuft alles wieder in normalen Bahnen“, versuchte ich die Misere herunterzuspielen.
Nebenan krähte unser mittlerweile einen Monat alter Sohn in seinem Bettchen.
Allzu oft werde ich ihn den kommenden Wochen wohl nicht zu Gesicht bekommen.
Hektisch schlang ich den Rest des Wurstbrotes herunter, spülte mit lauwarmen Kaffee nach, kramte das Fernglas aus dem Schrank, dann ging es auch schon wieder los.
Über die holprige, mit Schlaglöchern übersäte Fernverkehrsstraße 1 ins benachbarte Kietz.
Unterwegs kamen mir mehrere sowjetische Militärfahrzeuge entgegen. In dem ansonsten verschlafenen, eintausend Seelen-Dorf waren gleich zwei Regimenter der WGSS, der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, stationiert.
Neben deren erdbraunen Uniformen bestimmte das Blau der Reichsbahn das allgemeine Ortsbild. Wie es hieß, stand die Hälfte der Einwohnerschaft bei der Bahn in Lohn und Brot. Wobei der größte Teil das Privileg besaß, drüben in Polen, auf dem Grenzbahnhof Kostrzyn, zu arbeiten. Schon damals entstand so manche deutsch-polnische Freundschaft.
Punkt 16:00 Uhr erreichte ich die an der Karl-Marx-Straße gelegene, einzig verfügbare Telefonzelle des Dorfes. Von dort aus meldete ich beim „Operativen Diensthabenden“ den Beginn der Streife. Mit dem Moped ging es weiter bis zur Vorflutbrücke. An dieser Brücke endete die vom Grenzübergang Marienborn kommende, sich von West nach Ost wie ein langes graues Band ziehende F 1 für den öffentlichen Straßenverkehr.
Ein wenig abseits der Fahrbahn bockte ich meine Schwalbe auf. Anschließend nahm ich meinen Postenbereich in Augenschein. Vor dem Postenhäuschen, unmittelbar hinter der Brücke des Vorflutkanals stand ein mittelgroßer Sowjetsoldat Wache.
Dahinter lag die Oderinsel, auf der seit über vierzig Jahren das sowjetische Militär residierte. Terra incognita für jeden normalen DDR-Bürger.
Zunächst bemühte ich mich um einen ersten Überblick:
Auf der anderen Seite des trüben, träge dahinfließenden Odervorflutkanals, trabte eine kleine, von Sowjetsoldaten beaufsichtigte Viehherde.
Die Soldaten hielten Stöcke in den Händen. Mit denen sie hin und wieder die Rindviecher in eine bestimme Richtung lenkten.
Währenddessen marschierte eine andere Einheit über die Vorflutbrücke, vollzog einen Schwenk nach links, um dann aus meinem Gesichtsfeld zu verschwinden.
Knatternd fuhren mehrere Mopeds der Marken S 51, Star und Schwalbe an mir vorüber in den verdienten Feierabend.
Rot blinkend kündet das Andreaskreuz vor dem Bahnübergang an der Dammstraße in Richtung Bleyen das Herannahen eines Güterzuges an. Der Personenverkehr endet ja bereits am wenige hundert Meter westlich gelegenen Bahnhof Kietz.
Zu meiner Verwunderung sehe ich, wie eine Lokomotive, an der sich ein einzelner Personenwaggon befindet, den Schienenstrang in Richtung Polen entlang rattert.
In dem Waggon sitzen mehrere Männer in den Uniformen des DDR-Zolls, der Grenztruppen und der Reichbahn. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: die Zöllner und Grenzer befanden sich auf dem Weg zum polnischen Grenzbahnhof Kostrzyn.
Die Schrankenbäume öffnen sich. Mittlerweile hat sich eine kleine, überwiegend aus Trabbis zusammengesetzte PKW-Schlange vor dem Bahnübergang gebildet. Eingehüllt in dicke stinkende Abgaswolken, sehe ich dem Korso hinterher. Am Steuer saßen handfeste Männer in Arbeitsanzügen. Niemand erschien mir verdächtig, einen „ungesetzlichen Grenzübertritt“ zu planen. Irgendwann wurde es mir an den Bahnanlagen zu langweilig. Gemächlichen Schrittes wanderte ich auf der Dammstraße in Richtung Kuhbrücke.
Rechterhand erhoben sich die weithin sichtbaren Schornsteine der Zellulosefabrik Kostrzyn.
Obwohl die polnische Kleinstadt direkt gegenüber lag, hatte ich sie bislang noch nie betreten.
Meine Welt endete an der Oder. Linkerhand behinderten zunächst Bäume und Buschwerk den Blick ins weite Oderbruch. Dazwischen eine alte von einem über und über mit Entengrütze bedeckten Graben umgebene Lünette. So wurden die Außenforts der Festung Küstrin in der Fachsprache des Militärs genannt.
Vereinzelte Gehöfte duckten sich geradezu verschämt hinter Deich und Buschwerk.
Nach einem Kilometer gelangte ich an die „Wegspinne“, an der die Zufahrten nach Kuhbrücke und Neubleyen von der weiter nach Genschmar führenden Dammstraße abzweigen.
Hier öffnete sich die Landschaft meinen Blicken. Mit dem Fernglas streifte ich das Areal ab.
Mehrere Kilometer entfernt, zog ein einsamer Traktor seine Kreise. Rehe ästen friedlich vor einer schmalen Baumgruppe am Horizont. Hoch oben in den Lüften hält ein Habicht, die Schwingen weit geöffnet, Ausschau nach Beute. In der Ferne schimmern Futtersilos in der Herbstsonne. Meine Heimat präsentierte sich ebenso romantisch wie friedlich.
.
Weit und breit keine Spur von „Grenzverletzer“n.
Hatte ich denn etwas anderes erwartet?
Auf jeden Fall nahm ich die Aufgabe ernst!
Wobei ich mir einredete, an dieser Stelle „einen wichtigen Beitrag zum Schutz der DDR“ zu leisten.
Ein grüner Trabant-Kübel hielt direkt neben mir. Unter dem Verdeck hockten zwei, Felddienstuniformen tragende Fähnriche der Grenztruppen. Ich erkannte die für die Bereiche Genschmar und Groß Neuendorf zuständigen „Grenzabschnittsposten“.
Die Männer befanden sich auf dem Rückweg von einer Dienstversammlung im „Grenzabschnittskommando Frankfurt (Oder).
Im Stab des Frankfurter Grenzabschnittskommandos herrschte helle Aufregung. Wie das eben ist, wenn man brutal aus dem „Dornröschenschlaf“ gerissen wird. Von der Westgrenze würden momentan in aller Eile ganze Kompanien an die Oder verlegt, erfuhr ich von den Grenzern.
Einer der Fähnriche verglich die eingetretene Lage, mit der „Solidarnoc-Krise 1981 :
“„Damals wurde sogar das lange geplante Feldlager abgeblasen. Stattdessen hieß es verstärkte Grenzüberwachung. Das ging über mehrere Monate. Bis das ganze irgendwann im Sande verlief. Solange wird das jetzt bestimmt nicht dauern. Wartet den siebenten Oktober ab, dann wird es auch an der Grenze wieder ruhiger.“
Wirklich? Im Zuge der politischen Ereignisse in der damaligen Volksrepublik Polen ergab sich an der Staatsgrenze lediglich eine abstrakte Gefahr. Die SED fürchtete, dass Überschwappen der „Konterrevolution“. Ohne das es tatsächlich zu einem Anstieg „illegaler Grenzübertritte“ kam. Probleme ergaben sich lediglich im Bereich der Grenzübergangsstellen, an denen es Versuche von DDR-Bürgern gab, Informationsmaterial der verbotenen Gewerkschaft „Solidarnocz“, einzuführen. Dieses fiel jedoch ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich von Zoll und MfS. Die Grenztruppen an der Oder blieben von derartigen Erscheinungen weitgehend unberührt.
Ganz anders die Situation im Jahre 1989: In manchen Bereichen wurden innerhalb einer Woche mehr „ungesetzliche Grenzübertritte“ und/oder Festnahmen registriert, als sonst in einigen Jahren.
Ich verabschiedete mich von den Grenzern. Grübelnd, tief in Gedanken versunken, begab ich mich zurück zur Eisenbahnbrücke. Der „Achillesferse“ meines Verantwortungsbereiches.
Mein erster Grenzdienst verlief ohne Vorkommnisse. Schon am nächsten Morgen bezog ich, wie angewiesen, erneut Posten in Kietz.
Zwischen Bahnübergang und Vorflutbrücke hatte eine Gruppe Sowjetsoldaten Aufstellung genommen. Unter der Anleitung eines Offiziers vollführten die Soldaten Leibesübungen. Dabei wurde ein asiatisch ausschauender Soldat ständig von anderen gepiesackt. Solange, bis der Offizier ein lautes Machtwort sprach.
Als mich der Offizier erblickte, lächelte er und fragte: „Problem?“ „Nein, Nein“, wiegelte ich ab. Der Offizier lächelte erneut: „ Wir wissen Bescheid. Ihr habt zurzeit viele Probleme“.
Was immer damit auch gemeint haben dürfte, der sympathische Sowjetoffizier hatte Recht.
Anschließend streifte ich über den Oderdamm nach Kuhbrücke. Ein leichter Nebelschleier lag über dem kleinen, zwischen den Oderdämmen eingepferchten Dörfchen.
Die Arme auf dem Rücken verschränkt, ging ich auf den Hauptdeich zu. Vorbei an der zwischen Buschwerk eingewachsenen Ruine des „Bürgergartens“. Früher einer der beliebtesten Ausflugsgaststätte der Küstriner. Vorbei an den kleinen Häusern und dem seit einem Monat leeren Storchennest.
Nur am alten Fischerhaus sollte ich nicht ohne weiteres vorbeikommen. Hier wohnte Charlotte K., die Witwe des bereits vor mehreren Jahren verstorbenen Fischermeisters.
Im Oderbruch kannte man die rüstige, über siebzigjährige Dame vor allem unter ihrem Beinamen, Fischlotte. Den sie sich als Verkäuferin im Seelower Fischgeschäft in der Straße der Jugend redlich, unter aktiver Zuhilfenahme ihres unermüdlichen Mundwerkes, verdient hatte. Frau K. werkelte gerade im Vorgarten, als sie mich sah. Ein uniformierter Polizist erregt natürlich Aufmerksamkeit. „Watten, haben sie den Kietzer Dorfsheriff endlich in Rente geschickt? Du bist doch unser neuer ABV?“, rief sie mir zu. Ich schüttelte den Kopf. Lass dich bloß auf kein Gespräch ein, Uwe, dachte ich. Für solche Vorsätze war es jedoch zu spät. Gegen Fischlottes rhetorischen Künsten kam einfach niemand an. So mancher, der mit der Absicht den Laden betrat, lediglich ein paar Sprotten zu kaufen, schwatzte Lotte regelmäßig weiteres Flossenwild auf. Selbst die Radio-Sendung „Von Sieben bis Zehn in Spree-Athen“, widmete der berühmtesten Fischverkäuferin des Oderbruchs mehrere Minuten Sendezeit.
In den nächsten Minuten prasselte ein regelrechter Wortschwall auf mich ein.
Endlich gelang es mir, den Zweck meiner Streife zu erklären. Frau K. erklärte sich spontan bereit, sofort jeden Verdächtigen dem VPKA Seelow zu melden. Die Gunst des Augenblicks schamlos ausnutzend, begab ich mich zum nahen Oderdamm.
Entgegen der ausdrücklichen Weisung des Amtsleiters, ging ich nach vorn, „zur Linie“, zum sandigen, von Fußspuren regelrecht übersäten Oderufer.

Grenzdienst hat immer auch etwas mit Indianerspiel zu tun. Geländeerkundung, Spähen, Spurenlesen, wie weiland bei Karl May. Doch wie sollte man die Spuren von Anglern und Naturfreunden von denen von potentiellen „Grenzverletzern“ unterscheiden? Es gab nur eine Möglichkeit: das Ufer des Grenzstroms für die Öffentlichkeit abzusperren. Ein Gedanke, der mir absolut missfiel. Mein Fernglas leistete mir gute Dienste. Durch die Optik erschienen mir die Schornsteine der Zellulosefabrik zum Greifen nah. Ebenso die rot-weißen-Grenzpfähle am anderen Ufer der Oder. An dem ein einsamer Angler hockte und auf den großen Fang wartete. Ich schwenkte nach rechts. Erkannte eine Stahlgitterkonstruktion. Das musste die Eisenbahnbrücke sein. Dahinter schimmerte die Silhouette der Festung Küstrin im strahlenden Licht dieses herrlichen Herbstmorgens. So seltsam das jetzt auch klingen mag: ich kannte diese Festung bislang nur aus den Erzählungen Theodor Fontanes. Selbst gesehen hatte ich dieses Bauwerk noch nie. Hoch über einer Bastion, in unmittelbarer Nähe der Oderbrücke, erhob sich ein Obelisk. Ein Sowjetstern krönte den Obelisken. Wie es aussah, war der Stern im Lauf der Zeit in eine gefährliche Schieflage geraten. So schief, dass er irgendwann zu Boden stürzt. Ich setzte das Fernglas ab, massierte die Augenmuskeln, dann schoss es mir spontan durch den Kopf: Wenn das mal kein schlechtes Omen für die Zukunft des Sozialismus ist. Ob in Polen, Ungarn, der DDR und selbst in der Sowjetunion selbst, überall drohte dem „Roten Stern“ der Absturz.
Das Knattern eines Motorrades riss mich aus den trüben Gedanken. Auf dem Oderdamm näherte sich ein Grenzer. Er trug eine hellgrüne Krad-Kombination. Am Lenker der grasgrünen„MZ TS 250 /A“, A wie Armeeausführung, baumelte ein schwarz-weißer Verkehrsreglerstab.
Als mich der Grenzer erblickte, steuerte er die schwere Maschine den schmalen, vom Deich in die Oderwiesen führenden Weg herab. Umständlich bockte er das Motorrad auf, öffnete den Verschluss des runden Schutzhelms, nahm das unförmige Ding in die Hand und kramte eine Schachtel Zigaretten aus der Brusttasche. Nach einigem Überlegen erkannte ich den Grenzer als den für Kietz zuständigen Grenzabschnittsposten wieder. Von ihm hatte ich im April einen betrunkenen Mopedfahrer übernommen. Harry hieß der Grenzer, an seinen Familiennamen kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Den Grenzabschnitt teilte er sich mit einem Stabsfähnrich. Harry hatte es lediglich zum Stabsfeldwebel gebracht. Der -Grenzabschnitt Kietz- spielte in der operativen Beurteilung der Grenztruppen, auf Grund des Bahnhofes und der beiden sowjetischen Kasernen, offenbar eine größere Rolle, so dass ihn gleich zwei „ GAP“ überwachten.
„Was macht denn Polizei hier unten an der Oder?“, fragte Harry schmunzelnd. „ Na was wohl? Die Grenztruppen unterstützen“, gab ich zur Antwort. Der Stabsfeldwebel hob resigniert die Hände. „Da hat man uns eine schön was eingebrockt. Nächstes Jahr haue ich in den Sack. Dann suche ich mir eine Arbeit im zivilen Sektor. Ich habe die Schnauze voll, bei Wind und Wetter an der Oder herumzukriechen. Das wird doch hier immer schlimmer“, schimpfte Harry. Ja, was sollte ich dazu sagen? Stabsfeldwebel Harry wirkte wie jemand, der brutal aus dem gewohnten Rhythmus gerissen wurde. In dem folgenden, angeregten Gespräch zeigte sich mit aller Deutlichkeit, dass die angespannte Lage die Grenztruppen „kalt erwischt hatte“.
Von Beginn an wirkte das Fehlen eines „Grenzmeldenetzes“, zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen den im Abschnitt handelnden Posten und der Führungsstelle im Grenzabschnittskommando in Frankfurt (Oder), äußerst hinderlich. Normalerweise meldete sich der „GAP“, vor dem Beginn der Streife, telefonisch von seinem Dienstzimmer aus im Führungspunkt. Dort erhielt er die für ihn relevanten Informationen. Später, bei der Rückkehr, erstattete der Grenzer „den Führenden“, Bericht. Der im Allgemeinen mehr oder weniger knapp ausfiel. Zwischen den Gesprächen klaffte nicht selten ein Zeitfenster von mehreren Stunden. Was aber, wenn ein Grenzabschnittsposten, irgendwo in den Weiten Oderwiesen, auf einen oder mehrere, zu allem entschlossene Ausreisewillige stieß? Die ihn womöglich bedrohten oder gar attackierten? Über Funkgeräte verfügten vorläufig lediglich die Kräfte in direkter Nähe der Führungsstelle. Viel weiter hätte die Funkverbindung ohnehin nicht gereicht.
Wir schauten über die Niedrigwasser führende Oder hinüber nach Polen. Am jenseitigen patroullierte ein graugrün uniformiertes Postenpaar des polnischen Grenzschutzes Die Soldaten trugen ihre Maschinenpistolen zusammengeklappt, den Lauf nach unten gerichtet, auf den Boden. Neben einer Grenzsäule hielt die Streife kurz inne, einer der Soldat richtete sein Fernglas auf uns und hob die Hand zum knappen Gruß. Anschließend setzte die Streife ihren Postengang an der Oder fort.
„Sieht man die Jungs von der WOP auch mal wieder?“, zischte Harry. „Wieso?“, entgegnete ich verständnislos. „ Vorige Woche hatten wir in Slubice eine gemeinsame Beratung mit den Polen. Einer der Kommandeure hat uns, hinter vorgehaltener Hand, sein Leid geklagt. Seit einiger Zeit werden immer Leute von der Grenze zur DDR abgezogen. Einige Bereiche werden gar nicht mehr bestreift, die Beobachtungstürme kann er ebenfalls kaum noch besetzen. Aber was soll er auch machen? Der gute Mann ist Mitglied der PVAP. Kommunisten haben im polnischen Grenzschutz nicht mehr viel zu sagen. So sieht’s aus, mein Lieber. Von den Polen können wir jedenfalls nicht allzu viel Hilfe erwarten.“
Harrys Worte entsprachen unserem damaligen Denkschema. Der Grenzer gehörte, wie ich, der SED an. Für uns war es einfach unvorstellbar, dass eine andere Partei in den „bewaffneten Organen“ das sagen haben könnte. In dieser Hinsicht waren die Polen bereits mindestens einen großen Schritt weiter.
Anschließend gab mir Harry noch ein paar „Insidertipps“ hinsichtlich „meines Grenzabschnittes“. Im Gegensatz zu Hauptmann B. maß er der Eisenbahnbrücke keine Bedeutung zu: „Wer über die Eisenbahnbrücke nach Polen will, ist entweder absolut nicht mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut. Oder komplett bescheuert. Zuerst muss er ja an den „Koljas“ vorbei. Falls ihm das gelingen sollte, läuft er spätestens am anderen Oderufer dem polnischen Grenzschutz in die Arme. Die Brücke wird nämlich Tag und Nacht von einem Posten bewacht. Außerdem ist der Gang über die Schienen lebensgefährlich. Ich möchte, mitten auf der Eisenbahnbrücke, keinem entgegenkommenden Zug begegnen.“
Von einem Appell der niemals stattfand

Der Morgen des sechsten Oktobers hielt eine unangenehme Überraschung bereit: auf Grund der Lage war der für 09:00 Uhr angesetzte Ehrenappell „auf unbestimmte Zeit“ verschoben worden. So etwas hatte es wohl in der ganzen Geschichte des Volkspolizeikreisamtes Seelow noch nie gegeben. Wie sagte Unterleutnant Ro., der an diesem Tag Dienst als „ODH“ schob, am Telefon zu mir: „Der Appell wird nachgeholt, wenn es wieder ruhiger geworden ist. Im Moment ist hier niemanden nach Feiern zumute.“
Niemanden? Wer den „Neuen Tag“ aufschlug, las nichts als Erfolgsmeldungen, schaute in zufrieden lachende Arbeitergesichter, konnte nachlesen, wem so alles in diesen Tagen für besondere Leistungen eine staatliche Auszeichnung verliehen wurde. Nie war die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der DDR größer als unmittelbar vor den Feierlichkeiten zum vierzigsten Jubiläum.
Daheim berichtete mir meine Frau von einem Vorfall, der sich am Morgen im Bus von Manschnow nach Seelow abspielte. Dort hatte ein Fahrgast lautstark seiner Wut über die kürzlich erfolgte Schließung der Staatsgrenze zur CSSR Luft verschafft: „Jetzt haben uns die Kommunistenschweine vollends eingesperrt“, hatte der Mann, unter mehr oder weniger deutlich geäußerter Zustimmung der übrigen Fahrgäste gerufen.
Für 10:00 Uhr hatte Hauptmann B. eine Dienstberatung im Gebäude des Gruppenpostens angesetzt. Zur Vorbereitung des morgigen Feiertages gab es für uns jede Menge zu tun. Neben der Bestreifung der Volksfeste legte das VPKA besonderen Wert auf die Sicherheit der sowjetischen Soldatenfriedhöfe. Davon gab es gleich mehrere in meinem Abschnitt. Dafür brauchte ich am 07.Oktober nicht an die Oder. Hauptmann B. wirkte sichtlich bedrückt, auf seinen nicht allzu breiten Schultern die Hauptverantwortung für das kommende Wochenende. Niemand rechnete ernsthaft mit Straßenschlachten, wie in Dresden oder Leipzig. Dennoch konnte in der aufgeheizten Atmosphäre selbst im ruhigen Kreis Seelow bereits der kleinste Funke zur Explosion führen.
Draußen auf einem Feld, zwischen dem Weidenweg und der Fernverkehrsstraße 112, zog ein Traktor seine Runden. Nichts deutete daraufhin, dass dem Land ernsthaft Gefahr drohte. Hauptmann Werner Thie, der Abschnittsbevollmächtigte von Golzow und Gorgast, sprach aus, was wohl jeder dachte: „Die Politik des roll back des Sozialismus erweist sich zurzeit erfolgreicher denn je.“
Ich spürte, wie mir eine unsichtbare Faust die Kehle zudrückte. Diffuser Ausdruck latenter Zukunftsangst.
„Männer, ich zähle auf euch. Lasst uns gemeinsam die nächsten Tage überstehen. Am Montag sind wir klüger“, gab uns der Gruppenpostenleiter mit auf dem Weg. Zweckoptimismus oder „Pfeifen im Walde?“
Anschließend fuhr ich hinaus in den Abschnitt. Zwischen Sachsendorf und Rathstock kam mir ein Motorrad entgegen. Dem Kennzeichen nach zu urteilen, wohnte sein Besitzer irgendwo im Bezirk Neubrandenburg. Der Fahrer schaute sich kurz nach mir um, beschleunigte sofort und raste über die holprige Landstraße davon. Gründe, vor der Polizei zu fliehen, gab und gibt es viele. Im Oktober 1989, wenige Kilometer von der Staatsgrenze zu Polen entfernt, fiel mir jedoch nur ein einziger ein. Angesichts der ungleichen „PS-Stärke“, verbot sich eine Verfolgung des Flüchtigen von selbst. Dieser eigentlich unbedeutende Vorfall deprimierte mich zutiefst. Ich fühlte mich auf verlorenem Posten. Rat und hilflos, umgeben von anderen Rat- und Hilflosen.
Am frühen Nachmittag fuhr ich ins VPKA, um drei erledigte Ermittlungsberichte abzugeben. Dort herrschte eine unbeschreiblich angespannte Stimmung, wie vor einem nahenden Unwetter. Auf dem ansonsten völlig leeren, unheimlich ruhig erscheinenden Flur, unterhielt sich ein Uniformierter Kampfgruppenkommandeur mit dem Hausposten. Derweil führten Schutzpolizisten einen salopp gekleideten, an den Händen gefesselten jungen Mann die Treppe hinauf zur Vernehmung. Bei dieser Gelegenheit fiel mir ein, dass ich bereits seit Tagen einen Bericht für Oberleutnant V. mit mir herumschleppte. Ich ging ebenfalls nach oben. Durch die geöffnete Tür seines Dienstzimmers sah ich Klaus Wie., meinen Untermieter und „Telefonverantwortlichen“. Klaus hockte mit grauem Gesicht hinter dem Schreibtisch. Vor sich eine mechanische Schreibmaschine, in der sich ein eingespannter Papierbogen befand. Peter V. traf ich nirgends an. Zwei andere Offiziere der K hasteten an mir vorbei. Irgendwo klingelte ein Telefon. Nichts wie weg aus diesem Irrenhaus!
Die Fahne in der Mülltonne

Der siebente Oktober verlief in meinem Abschnitt, wie auch im gesamten Kreis Seelow, ausgesprochen ruhig. Beinahe schon unheimlich ruhig.
Meine Anwesenheit bei den lokalen Feierlichkeiten beschränkte sich auf das notwendige Mindestmaß. Dennoch wurde ich ständig von besorgten Bürgern zur Lage in der DDR angesprochen. Über den Köpfen der Menschen schwebte, unausgesprochen jedoch unübersehbar, die blanke Angst vor einer Eskalation im Lande. Zum Feiern war kaum jemand zumute. „He Sheriff, ich reise morgen nach Ungarn“, rief mir ein bereits sichtlich angetrunkener Dolgeliner LPG-Bauer zu. Wofür er einen derben Hieb von seiner besseren Hälfte erntete. „Halt die Schnauze, oder du bekommst kein Bier mehr“, zischte sie ihm ärgerlich zu. Ohne davon Notiz zu nehmen, setzte ich meinen Streifengang über den Festplatz fort.
Das war aber auch die einzige „Provokation“ des Tages.
Bei Einbruch der Dunkelheit fuhr ich mit meinem Moped Streife im Abschnitt, kontrollierte, wie verlangt, die sowjetischen Ehrenmale in den Dörfern. Niemand hatte sich an ihnen zu schaffen gemacht. Dennoch leuchtete ich jeden einzelnen Grabstein ab. Von einem der Grabsteine, in Alt Mahlisch, blickte mich das Konterfei eines ernst dreinschauenden Sowjetsoldaten an. Für einen Moment erschien es mir, als wollte der im April 1945 hier in der Nähe ums Leben gekommene Soldat eine stumme Botschaft in die Gegenwart senden. Blödsinn! Absoluter Blödsinn! Ich werde noch meschugge, wenn das so weitergeht. Für meine angespannten Nerven gibt es bessere Orte, als ausgerechnet diese „Heldenfriedhöfe“!
„Ab nach Hause“, befahl ich mir selber. Zuvor legte ich noch einen kurzen Zwischenhalt in meinem Dienstzimmer ein. Der „Operative Diensthabende“ wartet sicherlich bereits sehnsüchtig auf die Lagemeldung.
„Die Ehrenmale in Friedersdorf und Alt Mahlisch habe ich kontrolliert, es ist alles in Ordnung. Das Ehrenmal in Sachsendorf sehe ich mir auf der Rückfahrt an“, teilte ich dem „ODH“ mit müder Stimme mit. „Ansonsten ist in meinem Abschnitt alles ruhig.“ „Das ist schön“, antwortete der Diensthabende. „Leider ist es nicht überall so ruhig. In Berlin wird schon geknüppelt, hoffentlich muss heute Nacht nicht noch Alarm ausgelöst werden“, fügte der Offizier sorgenvoll hinzu. Schlagartig wich die Müdigkeit einer angespannten Unruhe. Zuhause fiel ich in einen unruhigen, von Alpträumen gestörten Halbschlaf. Immer wieder schreckte ich hoch, in der Annahme, das Funkgerät gehört zu haben. Gegen 07:00 Uhr stand ich leise auf. Mein Sohn schlummerte friedlich in seinem Bettchen. In den letzten Wochen hatte ich kaum Zeit gefunden, mich um ihn zu kümmern. Die ganze Last lag auf den Schultern meiner Frau. Soll sie sich einmal ausschlafen, dachte ich. Leise nahm ich das Funkgerät in die Hand, um mich damit ins Wohnzimmer zu verziehen. Just in diesem Moment ging der sattsam bekannte Funkspruch „Fasan 10 / 338 kommen Sie über Draht“ ein. Auf einem Schlag war es vorbei mit der morgendlichen Ruhe. Sofort streifte ich mir Hose und Pullover über, während der Kleine vor lauter Schreck seinen Frust über die abrupte Störung herausbrüllte. „Kannst du das Scheißding nicht wenigstens Sonntags ausschalten?“, fuhr mich meine Frau ungehalten an. Was für eine Frage! Sie wusste doch, dass ich mich praktisch in ständiger Bereitschaft befand. Mittlerweile lagen aber auch bei ihr die Nerven blank. Meine ständige Abwesenheit von Zuhause belastete zusehends das Familienleben. Da half auch die überstrapazierte Phrase „Du hast schließlich einen Polizisten geheiratet“ nicht weiter.
Innerlich betend, dass es sich nicht um eine Alarmauslösung handelte, stürzte ich die Treppen hinunter. Ich klingelte Sturm. Verschlafen öffnete Klaus W. „Tut mir leid, aber ich muss mal wieder telefonieren“, entschuldigte ich verlegen grinsend. Klaus wies auf den im Flur stehenden Apparat. „Du kennst dich ja aus“, sagte er, blieb jedoch in meiner Nähe. Meine Finger zitterten, als ich die Nummer des „Operativen Diensthabenden“ wählte. „Zwo Vierundzwanzig“ meldete sich eine mir bestens bekannte Männerstimme am anderen Ende der Leitung. Sie gehörte dem Hauptmann Gerhard Schm., „Guten Morgen, Genosse Hauptmann. Sie haben mich gerufen“, begrüßte ich, nichts Gutes ahnend, den Offizier. Das ungute Gefühl bewahrheitete sich sofort: „Genosse Bräuning, fahren Sie umgehend nach Dolgelin. In der Maxim-Gorki-Straße, direkt vor der Einfahrt zum LPG-Gelände, wurde in einer Mülltonne, eine heruntergerissene DDR-Fahne entdeckt. Melden Sie sich sofort, wenn sie den Einsatzort erreicht haben. Ich werde ihnen den K-Dienst hinterher schicken.“
Verdammt! Den gemütlichen Vormittag, so ganz in Familie, konnte ich wohl vergessen. Auch wenn es sich um keinen Einsatzalarm handelte. Aber das vorsätzliche Beschädigen von Fahnen gehörte in der DDR zu den „verabscheuungswürdigsten Verbrechen überhaupt“. Ganz besonders, wenn die Handlung im Zusammenhang mit einem Staatsfeiertag stand. Bei dem Einsatz des K-Dienstes dürfte es wohl nicht bleiben. Fiel solch ein Delikt nicht in das Ressort der Staatssicherheit? Mein Dienstzimmer befand sich kaum fünfzig Meter vom Auffindeort der „geschändeten“ Fahne entfernt. Beste Voraussetzung also, um den Ermittlern als Basis zu dienen.
Nun eilte ich die Treppe wieder hinauf. Schnell ins Bad, Waschen und rasieren. Dann noch schnell ein Marmeladenbrot essen. Für mehr blieb keine Zeit mehr. Endlich ein richtiger Kriminalfall bei dem ich zeigen konnte, was in mir steckt. Was sich, bezogen auf den aus heutiger Sicht unbedeutenden Vorfall, sicherlich befremdlich anhört. Damals stand ich jedoch am Anfang meiner Karriere. Wartet nicht jeder junge Polizist darauf, endlich sein Können unter Beweis stellen zu dürfen?
Vor Ort angekommen, fand ich das ganze bestätigt. Offensichtlich stammte die abgerissene Fahne vom Außenbereich des LPG-Verwaltungsgebäudes. Dem lädierten Aussehen nach zu urteilen, hatte jemand seine ganze Wut an dem Ding ausgelassen. Der Fahnenstock war zerbrochen und das Tuch mehrfach zerknüllt. Ich sah mich kurz um. Dolgelin wirkte wie ausgestorben. Das Dorf erholte sich noch von der feuchtfröhlichen Tanzveranstaltung. Es bedurfte keineswegs der Fähigkeiten eines Sherlock Holmes, um den Täter unter den Gästen der Veranstaltung zu vermuten. Möglicherweise schlief der Kerl in diesem Augenblick friedlich seinen Rausch aus. Ohne überhaupt zu ahnen, in welche Gefahr er sich mit der unbedachten Tat gebracht hat.
In diesem Moment bog ein knapp siebzigjähriger kahlköpfiger Mann um die Ecke. Ich kannte den alten Herren bereits. Er hieß Kurt und gehörte zu den wenigen Aktiven des Dolgeliner „VP-Helferzuges“, um den ich mich bislang kaum kümmern konnte. „Ach schön, dass ich unseren ABV auch mal wieder sehe“, greinte der VP-Helfer sogleich. Mühsam verkniff ich mir ein Lächeln. Kurt, den ich in Zukunft noch näher kennen und schätzen lernen sollte, erinnerte mich irgendwie an Fuzzi, den zahnlosen Hilfssheriff an der Seite von John Wayne. „Du weißt doch, was zurzeit los ist“, brummte ich. „So, was ist denn los? Warum werden wir Helfer dann nicht einbezogen? Warum stehst du am Sonntagmorgen neben der Mülltonne?“
Die ersten beiden Fragen blieben unbeantwortet im Raum stehen. Frage Nummer drei beantwortete ich mit einem Fingerzeig auf die geschändete Fahne. „Heute Nacht hat jemand diese Fahne heruntergerissen. In Kürze wird die Kriminalpolizei eintreffen. Könnte gut sein, dass ich deine Dienste heute noch benötige.“ Neugierig geworden, trat Kurt näher. Nachdem er die Fahne ausgiebig durch seine dicken Brillengläser betrachtet hatte, überraschte er mich mit einer überaus wichtigen Information: Gegen Mitternacht war es bei der Tanzveranstaltung zu einem Zwischenfall gekommen. Ein völlig betrunkener Gast hatte andere, ihm als SED-Mitglieder bekannte Gäste beschimpft. Solange, bis man ihn unsanft vor die Tür beförderte. Draußen soll der besagte Gast weiter herumrandaliert und auf Gott und die Welt, oder besser gesagt auf DDR und SED, geschimpft haben. Ich fühlte mich wie elektrisiert: „Kennst du den Wüterich?“ Kurt lachte schallend. „Du kannst Fragen stellen. Peter K. ist sein Name. Er wohnt unten in Friedenstal und arbeitet hier auf der LPG.“
In diesem Moment hätte ich den Alten am liebsten umarmt. Wider Erwarten stand der lang ersehnte Kriminalfall bereits unmittelbar nach dem Bekanntwerden vor der Aufklärung. Anerkennend klopfte ich den VP-Helfer auf die Schultern. „Pass du bitte auf die Fahne auf. Ich muss unbedingt mit dem VPKA telefonieren.“
Im Laufschritt rannte ich ins Büro. Hauptmann Schm. nahm meine Meldung erfreut entgegen. „Gut gemacht, Genosse Bräuning! Mit solch einem schnellen Erfolg hätte ich nicht gerechnet. Der K-Dienst befindet sich noch anderweitig im Einsatz. In höchstens einer Stunde wird er bei ihnen sein, dann stimmen wir das weitere Vorgehen ab.“
Gut gemacht Genosse Bräuning! Die Worte des Hauptmanns gingen mir herunter wie Öl. Dabei verdrängte ich, dass mir die Aufklärung quasi „wie eine reife Frucht“ in den Schoss gefallen war.
Wir unterhielten uns noch eine Weile. Dann verließ mich VP-Helfer Kurt wieder. Die Zeit verging, ohne dass der K-Dienst eintraf. Vielleicht gab es an diesem Morgen noch mehr für ihn zu tun? Nach neunzig Minuten „Standposten“, wurde ich allmählich ungeduldig. Nach Vollendung der zweiten Stunde, radelte ein in der Nähe wohnender ehemaliger Volkspolizist heran: „Komm mit in meine Wohnung. Der „ODH“ ist am Telefon. Es ist dringend!“ Soll ich die Fahne etwa aus den Augen lassen? Irritiert folgte ich den Ex-Polizisten.
„Hauptwachtmeister Bräuning“, meldete ich mich, in Erwartung weiterer Anweisungen am Telefon. „Hören Sie bitte ganz genau zu“, sagte Hauptmann Schm. eindringlich. Nach einer kurzen Kunstpause, forderte er mich auf, die Fahne im Dienstzimmer einzuschließen. Und sie am nächsten Tag an den LPG-Vorsitzenden zu übergeben. „Ja und was wird mit den weiteren Ermittlungen?“ „Genosse Bräuning, in dieser Angelegenheit wird es keine Ermittlungen geben! Sorgen Sie bitte dafür, dass jeder, der bereits von dem Vorfall Kenntnis besitzt, unbedingtes Stillschweigen bewahrt! Das gilt natürlich auch für ihre Person!“
Es gibt Augenblicke, da versteht man die Welt nicht mehr. Dieser gehörte unzweifelhaft dazu.
Hauptmann Schm. lieferte kleinlaut die Erklärung: „Diese Anweisung stammt von der Kreisdienststelle. Peter K. sitzt für die CDU im Seelower Kreistag. Er ist also ein aktives Mitglied einer Blockpartei der SED. Was soll denn die Bevölkerung denken? Am Ende sagen sich die Leute noch: Wenn man schon in befreundeten Parteien so über die DDR denkt, dann wird wohl etwas Wahres dran sein! Nein, in einer Situation wie momentan, können wir uns Ermittlungen gegen ein im Kreis bekanntes Mitglied einer Blockpartei nicht leisten.“
Ich benötigte einige Sekunden, um das gehörte einigermaßen zu verstehen. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen erlebte ich hautnah jenen eigenartig anmutenden Umgang der DDR mit den eigenen Gesetzen. Wenn es politisch opportun erschien, konnte schon mal auf die Strafverfolgung verzichtet werden. Während in anderen, durchaus vergleichbaren Fällen, die „ganze Härte des Gesetzes“ zur Anwendung kam. Ob oder inwieweit jemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde, hing also durchaus von der jeweiligen Person ab. Erschreckend auch, dass eine Kreisdienststelle für Staatssicherheit ohne weiteres die Einstellung von Ermittlungen verfügen konnte. Oblag so etwas nicht allein dem Staatsanwalt? Dieses Lehrbeispiel sozialistischer „Rechtsstaatlichkeit“, weckte zum zweiten Mal innerhalb Zweifel am Sinn meiner Tätigkeit als Polizist. Sind nicht vor dem Gesetz alle gleich? Egal ob Kreistagsabgeordneter oder nicht? Was wäre geschehen, wenn die Fahne von einem ganz normalen Bürger abgerissen worden wäre? Hätte die Kreisdienststelle für Staatssicherheit dann ebenfalls die Einstellung der Ermittlungen verfügt? Überhaupt, entscheidet nicht allein der Staatsanwalt ob Ermittlungen eingestellt werden oder nicht?
Hauptmann Schm. schickte mich anschließend zu einem Kaninchendiebstahl nach Alt Mahlisch. Bei solch profanem Alltagskram redete einem wenigstens die Staatssicherheit nicht herein.
Anschließend tippte ich meinen Bericht im Dienstzimmer und fuhr anschließend nach Hause. In Sachsendorf überholte mich ein mit Jugendlichen besetzter Trabant. Die Insassen zeigten mir dabei lachend das „Victory-Zeichen“. Einmal mehr verspürte ich den „berühmten Stich in der Magengrube“. Selbst im sonst so friedlichen Oderbruch gerieten die festgefügten Strukturen immer mehr aus den Fugen. Dass die DDR kurz vor dem Untergang stand, ahnte ich zu jenem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Immer wieder redete ich mir ein, dass sich die Lage in den kommenden Tagen wieder beruhigen würde.
Daheim angekommen, sah ich mir im ZDF die Nachrichten an. Der Nachrichtensprecher sprach von schweren Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in Ostberlin, Potsdam, Magdeburg und Plauen. In meinem Innern breitete sich ein ungutes Gefühl aus. Oder war es bereits die Angst vor dem Ungewissen?
Am Abend berichtete die „Aktuelle Kamera“ von den Rowdys und Randalieren, welche an einigen Orten die Volksfeste stören wollten. Jedoch von Volkspolizisten und Bürgern an ihrem Vorhaben gehindert wurden. Ohne weitere Details zu nennenden, ging Nachrichtensprecherin Angelika Unterlauf zur „Tagesordnung“ über. Noch immer gab ich mich der Illusion hin, dass sich die Lage in den kommenden Tagen wieder beruhigen würde. Schließlich war der vierzigste Jahrestag der DDR endgültig vorbei. Die Illusion sollte bereits am nächsten Morgen ein jähes Ende finden.
Genossen: wir befinden uns mitten in einer Konterrevolution!?
Der später als Beginn der Wende in die Geschichtsbücher eingegangene 9.Oktober war erst knappe fünfeinhalb Stunden alt, als es plötzlich an meiner Wohnungstür klingelte. Überrascht und noch ein wenig schlaftrunken, öffnete ich die Tür. Wer bekommt schon um diese Zeit Besuch? Untermieter Wie. stand, gleichfalls nicht gerade fris ch aussehend, im grauen Morgenmantel davor.
ch aussehend, im grauen Morgenmantel davor.
„Um 07:30 Uhr sollen sich alle Abschnittsbevollmächtigten im Schulungsraum des VPKA einfinden. Anweisung vom Alten“, nuschelte Wie., ehe er sich in die eigene Wohnung zurückzog. Bis es soweit war, blieb mir noch genügend Zeit für ein ausgiebiges Frühstück. Ich redete mir ein, dass Oberstleutnant N. eine Bilanz des vergangenen Wochenendes ziehen wollte. Dazu gesellte sich die Hoffnung, dass der seit Wochen andauernde „inoffizielle Einsatzalarm“ allmählich aufgehoben wird.
„Ich mache drei Kreuze, dass dieser verdammte Republikgeburtstag endlich vorbei ist“, sagte ich zu meiner Frau, während sie den Morgenkaffee kochte. „Du meinst also, dass alles wieder in normalen Bahnen verläuft?“ Ich zwinkerte ihr zu. „Aber sicher doch! Welchen Grund sollte es denn geben, die Leute verrückt zu machen?“
So ganz traute ich meiner eigenen Aussage nicht. Meine Sorgen behielt ich an diesem Montagmorgen lieber für mich. Zum einen, um keine unnötige Panik zu schüren, zum anderen, weil ich mir nicht sicher war, dass mich meine Frau tatsächlich verstand. Außerdem stand mir nicht der Sinn nach Grundsatzdiskussionen. Ich wusste doch selbst nicht, was die kommende Zeit bringen würde.
Gegen 07:25 Uhr rückten die Abschnittsbevollmächtigten des Volkspolizeikreisamtes Seelow in den im oberen Stockwerk gelegenen großen Schulung & Versammlungsraum. Zwischen all den zumeist langgedienten, teils über fünfzigjährigen Polizisten, fühlte ich mich noch immer reichlich seltsam. Konnte ich doch mit meinen „zarten“ fünfundzwanzig Lebensjahren, auf gerade einmal vier Dienstjahre bei der VP zurückblicken. Von meinen vergleichsweise niedrigen Dienstgrad ganz zu schweigen.
Vor dem Beginn der Versammlung, wechselte ich ein paar kurze Worte mit Hauptmann B.. Die Zeit reichte jedoch nicht aus, um ihm von der abgerissenen Fahne und der „von oben“ angeordneten Einstellung der weiteren Untersuchungen des Falls zu berichten.
Punkt 07:30 Uhr betrat Oberstleutnant N., „der Alte“, in kerzengerader Haltung den Versammlungsraum. Oberleutnant Norbert W., der Leiter des „Gruppenpostens Nord“, rief militärisch knapp „Aaaaachtung“. Fast gleichzeitig sprangen daraufhin die anwesenden Volkspolizisten von den Stühlen auf. Stramm, die Hände an die Hosennaht gepresst, harrten wir der obligatorischen Grußworte des Amtsleiters. „Guten Morgen Genossen Offiziere“, bellte der Oberstleutnant. „Guten Morgen Genosse Oberstleutnant“, antworteten die Abschnittsbevollmächtigten wie aus einem Munde. Als einziger „Nichtoffizier“ in der Runde, hätte ich genaugenommen den Mund halten müssen. Ich fühlte mich jedoch durch dieses „Guten Morgen Genossen Offiziere“ regelrecht geschmeichelt. Außerdem leistete ich nicht dieselbe Arbeit wie ein Hauptmann? Da darf man sich schon mal vorfristig als Offizier anreden lassen.
Es war jedoch nicht die Zeit, für kleinliches Statusdenken. Langsam, jedes einzelne Wort wohl überlegt, erklärte der Oberstleutnant den Grund der so kurzfristig anberaumten Versammlung:
„Genossen, ich habe euch zu mir gerufen, weil sich die ohnehin seit längerem angespannte Situation in der Republik seit dem vergangenen Wochenende zusätzlich verschärft hat. Leider müssen wir davon ausgehen, dass sich die Lage stündlich weiter verschärft.“
N. legte eine sekundenlange Pause ein, wobei er prüfend in die Gesichter seiner Unterstellten schaute. „Eines müssen wir uns mit aller Deutlichkeit bewusst sein: Wir befinden uns gerade inmitten einer Konterrevolution! Leider wird der absolute Ernst der Lage noch nicht überall erkannt. Selbst in der SED-Kreisleitung Seelow nicht. Am Freitag wurde mir noch der Mund verboten, als ich in einer Besprechung mit dem 1. Sekretär darauf hinwies, dass in der DDR die Konterrevolution tobt.“
Dem Oberstleutnant stand die Empörung über die „ungläubigen“ Genossen ins Gesicht geschrieben. In den Gesichtern der übrigen Polizisten spiegelte sich dagegen Schreck und Entsetzen wieder. Konterrevolution galt als Pseudonym für Terror und Gewalt. Sofort wurden die überlieferten Bilder des 17. Juni 1953 wach. Ich verspürte wieder einen schmerzhaften Stich in der Magengegend. Statt der erwarteten Entspannung drohte nun unvorstellbares Chaos.
Oberstleutnant N. setzte seine Rede fort:
„Genossen, in diesen Tagen geht es um nichts weniger als den Erhalt der Macht im Lande.“ N. erhob den Zeigefinger der rechten Hand und fügte unter Betonung hinzu: „Wenn wir diese Macht nicht aus den Händen geben wollen, dann werden wir auch bei uns nicht an Geschehnissen wie auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking vorbeikommen.“
Neben mir saß der beinahe sechzigjährige Hauptmann Günther Lau., der Abschnittsbevollmächtigte von Falkenhagen und für mich so etwas wie ein väterlicher Freund. „Von mir aus kann passieren was will“, flüsterte er mir ins Ohr, „Hauptsache es fließt kein Blut.“ Krampfhaft bemüht, die aufkommende Panik in den Griff zu bekommen, nickte ich ihm zu. Unwillkürlich stellte ich mir den von Leichen übersäten Seelower Puschkinplatz vor. Sollte so etwa die Zukunft der DDR aussehen? Günter gehörte zu der Generation, welche die Schrecken des Zweiten Weltkrieges hautnah erleben musste. Er wusste also, was Blutvergießen bedeutet.
Der Oberstleutnant trank einen Schluck Wasser. Ehe er sich den Ereignissen im relativ fernen Leipzig widmete. Theatralisch mit den Händen fuchtelnd, sagte der Offizier:
„Genossen, der Sozialismus ist doch so eine gute Sache. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn man sieht, wie in Leipzig gegen den Sozialismus demonstriert wird, da kann man ja nur zur Kalschnikow greifen. Für heute Abend haben reaktionäre Kräfte erneut zur Demonstration aufgerufen. Wir können uns das nicht mehr lange gefallen lassen. Wenn wir, wie gesagt, die Macht weiter in den Händen behalten wollen.“
Niemand stimmte dem Oberstleutnant zu. Niemand sagte auch nur ein Wort. Stattdessen betretenes Schweigen. Ich schaute durch das meinem Platz gegenüberliegende Fenster nach draußen. Auf der Clara-Zetkin-Straße rollte der übliche Verkehr. Trabbis, Wartburgs, Ladas. Dazwischen ein paar Lastkraftwagen der Marke W 50. Passanten liefen, Einkaufstaschen in den Händen haltend, am „Kaufhaus des Friedens“ vorbei. Nichts erschien anders als sonst. Und dennoch hatte ich das Gefühl, dass sich in Mitten der alltäglichen Friedlichkeit eine ungeheure Bedrohung zusammenbraute. Am liebsten wäre ich sofort nach Hause gefahren. Zu meiner kleinen Familie, um sie zu schützen.
N.s nächste Horrormeldung forcierte dieses Gefühl noch zusätzlich:
„Ich rechne stündlich mit Meldungen über vom Mob aufgehängte VP-Angehörige oder SED-Funktionäre. Wir müssen uns auf das schlimmste gefasst machen. Als Abschnittsbevollmächtigte stehen sie, da draußen völlig auf sich allein gestellt, sozusagen in vorderster Front. Sie sind somit ganz besonders gefährdet. Im Anschluss an die Versammlung werden sie in der Waffenkammer einen Schlagstock empfangen. Damit Sie sich, im Falle eines Angriffs, wenigstens ein wenig zur Wehr setzen können. Des Weiteren weise ich hiermit an, dass Sie sich zweistündlich telefonisch beim „Operativen Diensthabenden“ melden. So kann ich mir wenigstens sicher sein, dass Sie noch am Leben sind. Ich wünsche uns allen, dass wir die kommenden Ereignisse gesund überstehen.“
Auf dem Weg in die Waffenkammer sprach noch immer niemand mit den anderen. So als ob N.s Worte einen kollektiven Schock ausgelöst hätten.
Hauptmann B. tippte mir unterwegs sacht auf die Schulter:
„Ich lass mich nachmittags bei dir im Dienstzimmer sehen.“ Normalerweise wäre jetzt ein derber Scherz erfolgt, aber danach war selbst ihm nicht zumute.
In Dolgelin angekommen, begab ich mich sofort ins Büro des LPG-Vorsitzenden. Wortlos überreichte ich ihm die lädierte Fahne. „Meine Fresse“, stöhnte der Vorsitzende kopfschüttelnd. Dann stellte er die obligatorische Frage, was es denn sonst so neues bei der VP gäbe? Normalerweise fallen Dienstversammlungen unter die dienstliche Schweigepflicht. In diesem konkreten Fall lief ich jedoch Gefahr, an dem Gehörten regelrecht zu ersticken, falls ich mich nicht augenblicklich darüber austauschen konnte! Der LPG-Vorsitzende, ein gestandener Mann, noch dazu langjähriges Mitglied der SED, erschien mir als durchaus geeignet. Bei meiner Schilderung zeigten sich tiefe Falten des Unglaubens auf der Stirn des Dolgeliner LPG-Chefs. Als ich dann noch davon sprach, dass bereits mit „gelynchten“ Volkspolizisten gerechnet wird, verlor er vollends die Fassung. „Sage mal ehrlich, du glaubst doch diese Scheiße nicht etwa? Ist eure Führung jetzt völlig bescheuert?“ Anschließend wies er mit dem Finger auf den LPG-Hof hinaus. Wo gerade ein paar Bauern um einen im Stand vor sich hin blubbernden Traktor herumstanden. „Meinst du, dass da draußen irgendjemand die Absicht hegt, den ABV an der nächsten Laterne aufzuknüpfen? Nun lasst doch bitte die Kirche im Dorf!“
Der LPG-Vorsitzende hatte mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich schämte mich, N.s Befürchtungen, zu denen die friedvolle Normalität einen sonderbaren Kontrast bildete, ungefiltert weitergegeben zu haben.
Seit jenem 9. Oktober 1989 ist mittlerweile beinahe ein Vierteljahrhundert vergangen. Selbst der kluge LPG-Vorsitzende konnte nicht ahnen, dass die Sicherheitslage in der DDR tatsächlich am berühmten „seidenen Faden“ hing. Nicht in Seelow oder Frankfurt (Oder), sondern zweihundert Kilometer weiter südlich in Leipzig, der von Oberstleutnant N. gebetsmühlenartig erwähnten Messestadt entschied sich an diesem Tag das weitere Schicksal der DDR. Und möglicherweise auch mein eigenes.
Über die für den weiteren Ablauf der politischen Wende in der DDR letztendlich richtungsweisenden „Montagsdemo“ wurde von den Historikern bereits ausführlich berichtet. Ebenso über die noch immer nicht vollständig beantwortete Frage eines seitens der Verantwortlichen innerhalb des Sicherheitsapparates erwogenen Einsatzes von Schusswaffen. Sich teilweise widersprechende Aussagen und sich daraus ableitende Hypothesen sind bereits ausreichend vorhanden. Nichts liegt mir ferner, als dem eine weitere Hypothese hinzuzufügen. Dennoch lassen mir bis heute folgende Fragen keine Ruhe:
-
Warum wurde am Morgen des 09. Oktobers in aller Eile eine außerordentliche Dienstversammlung einberufen?
-
Sollte uns der Oberstleutnant, unter direktem Hinweis auf das Pekinger Massaker und die anstehende Demonstration in Leipzig, auf ein unmittelbar bevorstehendes Massaker in Leipzig und dessen Auswirkungen auf die gesamte DDR vorbereiten?
-
Was wollte man mit den auf keiner realen Basis stehenden Meldungen über vom Mob erhängte Volkspolizisten oder Parteifunktionäre erreichen? Etwa die Zustimmung für ein hartes Vorgehen gegen den „Mob“?
Fragen über Fragen, auf die es bislang keine Antwort gibt. Da sich die damaligen Verantwortungsträger noch immer diesbezüglich in Schweigen hüllen, werden diese Fragen wohl auf immer unbeantwortet bleiben.
Mein ganz persönlicher „illegaler Grenzübertritt“

Am 18. Oktober trat, für viele nicht überraschend, Erich Honecker von all seinen Posten zurück. Egon Krenz, schon seit langem als „Kronprinz“ gehandelt, übernahm das Ruder. Bahnten sich nun tatsächlich Veränderungen im Land an? Ehrlich gesagt, hätte ich mir jemand anderes in dieser verantwortungsvollen Position gewünscht. Als ausgerechnet den als Alkoholiker verschrienen Egon Krenz. Dessen Person eher für eine, im Sinne der bisherigen Politik, konservative Linie stand.
Während eines Streifengangs in Kietz lernte ich kurz darauf, einen im Bereich des Bahnhofes eingesetzten Oberleutnant der Transportpolizei kennen. Der blauuniformierte Kollege langweilte sich fürchterlich auf seinem Posten im Stellwerk. Den er so oft es ging verließ. Ich traf ihn zum ersten Mal direkt am Bahnübergang. Wir unterhielten uns über dieses und jenes, wobei wir schnell eine Gemeinsamkeit entdeckten: das Interesse an der regionalen Geschichte, wobei sich der Oberleutnant als „wandelndes Geschichtsbuch“ entpuppte. Besonders was die Stadt Küstrin anging. Aus offiziell zugänglichen Quellen stammte sein Wissen sicher nicht, die DDR hielt sich, in allem was den „verlorenen Deutschen Osten“ betraf, absolut bedeckt. Nach eigenem Bekunden stammte der Oberleutnant aus der Umgebung von Kietz. Sein Großvater hatte ihm viel von Küstrin erzählt. Schwer vorstellbar, dass wir uns genaugenommen in einem Teil dieser Stadt befanden.
„Möchtest du mich auf einem Kontrollgang über die Eisenbahnbrücke begleiten? Ich habe von meinem „ODH“ den Auftrag bekommen, dort nach dem Rechten zu sehen. In der vergangenen Nacht hat es dort wohl wieder mal jemand versucht nach Polen zu kommen. Dann brauche ich wenigstens nicht alleine über die Gleise zu turnen.“
Mit dieser Bitte rannte der Oberleutnant, bei mir gewissermaßen offene Türen ein.
Unverhofft eröffnete sich für mich die Gelegenheit, das verbotene Terrain der Oderinsel zu betreten. Wer schlägt schon solch eine Möglichkeit aus? Bedenken hatte ich trotzdem: „Hoffentlich kommt uns nicht gerade ein Zug entgegen.“ Lachend versuchte der Oberleutnant meine Ängste zu zerstreuen. „Ich habe mich im Stellwerk erkundigt. In der nächsten Stunde rollt kein einziger Zug über die Oder. Wem, wenn nicht mir, einem Offizier der Transportpolizei, kannst du in dieser Hinsicht vertrauen?“
Zuerst überquerten wir die Eisenbahnbrücke über den Vorflutkanal. Nach wenigen Metern waren wir bereits in der Sperrzone angekommen.
Zum ersten Mal sah ich die altehrwürdigen, aus der Kaiserzeit stammende Artilleriekaserne vor mir. Einer meiner Großonkel hatte hier Anfang der vierziger Jahre als Berufssoldat gedient. Ich erzählte meinen Begleiter davon. „Dann hat dein Verwandter im I. Artillerieregiment Nummer 39 gedient“, sprudelte es wie aus der Pistole geschossen aus seinem Mund. „Ja, wenn du es sagst.“, erwiderte ich verblüfft über so viel Detailkenntnis.
Vor der Kaserne marschierte eine Gruppe Sowjetsoldaten, die Schiffchen lässig in den Nacken geschoben, die Straße entlang. Zwischen den Gleisen und den Kasernengebäuden befand sich ein Sportplatz, auf dem andere Soldaten unter der Anleitung eines Offiziers, Sportübungen absolvierten.
„Lebt dein Großonkel noch?“, fragte der Oberleutnant. „Ja, warum?“ „Dann kannst du ihm ja berichten, dass du seine Kaserne aus der Nähe gesehen hast.“ Ich zog die Augenbrauen in die Höhe. „Daraus wird wohl nichts. Der alte Herr lebt seit einiger Zeit bei seinem Sohn im Westen“, bedauerte ich. Für mich war er damit tabu. Nicht, weil ich ihn nicht leiden konnte. Oder weil ich es mir so ausgesucht hatte. Sondern, weil es die Dienstvorschrift nun einmal verlangte, dass Volkspolizisten keine privaten Beziehungen zu Bundesbürgern unterhalten.
Es könnte ja sein, dass der gute Großonkel inzwischen vom Bundesnachrichtendienst angeworben und speziell auf mich angesetzt wurde. Was natürlich absoluter Schwachsinn war. Aber solche schwachsinnigen Vorschriften bestimmten damals mein Leben.
Ohne weiter auf dieses Thema einzugehen, setzten wir den Patrouillengang fort. Zeitweise fühlte ich mich wie ein in unbekannte Welten vorstoßender Entdecker. Oder ein Trapper inmitten feindlicher Indianer.
Der Oberleutnant machte mich auf einzelstehendes Gebäude in unmittelbarer Gleisnähe, aufmerksam:
„Das war mal der Bahnhof Küstrin-Altstadt. Die Russen haben daraus eine Art „Med-Punkt“ gemacht. Ich könnte mich jedes Mal aufregen, wenn ich sehe, wie heruntergekommen der Bahnhof heute ist.“ Verwirrt fragte ich noch einmal nach: „Wieso Küstrin-Altstadt? Sind wir hier nicht mehr in Kietz?“ „Kietz oder Küstrin-Kietz wie der Ort bis 1945 hieß, liegt westlich des Oderdamms. Ab der Vorflutbrücke beginnt bereits die Altstadt von Küstrin.“
Hinter dem zum Med-Punkt umfunktionierten Bahnhofsgebäude tauchte die durchaus imposante Eisenbahnbrücke in unserem Blickfeld auf. Eine mächtige Stahlgitterkonstruktion umschloss beidseitig das Bauwerk, davor ein Grenzpfahl aus Beton, versehen mit dem Staatswappen der DDR. Neben der Brücke entdeckte ich einen verfallenen Beobachtungsbunker. Überbleibsel aus der Zeit , als die Brücke auch auf DDR-Seite von Grenzsoldaten bewacht wurde.
„Wenn das mit den illegalen Grenzübertritten so weitergeht, wird hier bald wieder ein Grenzposten hocken. Hoffentlich bekommt unsere Regierung das Problem endlich in den Griff bekommt.“ Der Oberleutnant wandte sich um und erwiderte: „Solange sich bei uns nichts Grundlegendes ändert, werden die Leute weiter das Land verlassen. Ich für meinen Teil hoffe, dass die da oben sich endlich fragen, warum die Leute abhauen. Und wie sie die Unzufriedenen weiter im Lande behalten können. Ich bezweifele jedoch, dass Krenz dafür der richtige dafür ist. Der ist doch auch nicht viel klüger als Honecker!“
Der Oberleutnant überraschte mich immer mehr. Ich hörte nicht zum ersten Mal, dass sich in der DDR dringend etwas ändern musste. Innerlich teilten auch viele Volkspolizisten diese Auffassung. Aber das ein mir eigentlich fremder Offizier sich so offen zu Veränderungen bekannte, stellte nun doch ein Novum dar.
Rechterhand zog sich eine weitere, ebenfalls mit einer Käfigartigen Stahlgitterkonstruktion versehene Brücke über den träge dahinfließenden Oderstrom. Durch das Okular meines Fernglases sah ich einen einsamen Sowjetsoldaten, auf der ansonsten leeren Brücke Wache schieben.
Scharen von Wildgänsen flogen in der typischen Formation hinüber ans polnische Ufer. Nur die Tiere allein besaßen das Privileg, ungehindert diese Grenze zu passieren. Östlich unseres Standpunktes erhoben sich die übrig gebliebenen Wälle der in Schutt und Asche liegenden Festung Küstrin.
Der Oberleutnant ging festen Schrittes voran. „Kannst du dir vorstellen, dass über die Brücke da drüben früher Straßenbahnen fuhren? Direkt vom Bahnhof Küstrin-Neustadt bis zum Bahnhof Kietz. Autos und Pferdekutschen haben diese Brücke ebenfalls benutzt. Und jetzt? Jetzt fahren höchstens mal ein paar Militärtransporte darüber. Ansonsten herrscht das ganze Jahr über Grabesstille“ , sinnierte er ohne seinen Lauf zu unterbrechen.
Mir fiel ein, dass die Grenze zwischen der DDR und Polen irgendwo in der Mitte des Stromes verlief. Hatten wir diese nicht längst erreicht? Offenbar nicht, denn der ortskundige Transportpolizist lief unbeirrt, munter schwatzend, weiter. „Ich fürchte, wir sind bald in Polen“, unkte ich so laut, dass der Oberleutnant seine Konversation unterbrach. „Was heißt bald? Wir sind bereits in Polen“, verkündete er grinsend. So als wäre es völlig normal, dass zwei Volkspolizisten mal eben so eine Staatsgrenze überschritten. Durch meinen Kopf schwirrten tausend Gedanken. Wollte der Oberleutnant etwa auch in Richtung Warschau verschwinden und mich zwingen mitzukommen? So etwas kennt man ja aus diversen Romanen. Den unsinnigen Gedanken verwerfend, latschte ich wie ein Hund dem Oberleutnant hinterher. Kehr endlich um, flehte ich den Transportpolizisten in Gedanken an.
Ich konnte mir beim besten Willen keinen Reim auf das seltsame Verhalten machen.
Auf der polnischen Seite wurde die Eisenbahnbrücke noch immer von bewacht. Der Diensthabende Posten beäugte uns bereits seit einiger Zeit durch sein Fernglas. Unruhig lief er, das Dienstfernglas an die Augen gepresst, vor einem in den polnischen Landesfarben gehaltenen Schilderhaus auf und ab. Der Anblick zweier sich unbeirrt nähernden Uniformierter irritierte den Grenzwächter. An seiner linken Schulter baumelte ein Handfunksprechgerät.
Reflexartig nahm er das Gerät in die Hand. In dem Moment, als der Posten den „ungesetzlichen Grenzübertritt“ melden wollte, hob der Oberleutnant grüßend die Hand. Sichtlich irritiert, erwiderte der Pole den Gruß. Der Oberleutnant vollführte eine halbe Drehung nach links. Endlich nahm er wieder Kurs in Richtung DDR.
Ein paar Schritte, die mir verdammt lang erschienen, dann hatten wir die unsichtbare Staatsgrenze erneut überschritten. Diesmal jedoch in die „richtige Richtung“.
In meinem Inneren tobte ein regelrechter „Gefühlstornado“. Wir hatten soeben einen
„illegalen Grenzübertritt“ begangen. Dabei war es doch unsere Aufgabe, gerade solche Vergehen zu verhindern! Je mehr ich darüber nachdachte, desto aufgeregter wurde ich. Jedoch nicht vor Scham, sondern vor Freude! Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl erlebt, eine Grenze zu übertreten. Einfach so, ohne vorher jemanden zu fragen. Über diese Grenze konnte ich dann ebenso ungehindert wieder zurückkehren. Was ist eigentlich so schlimm daran, über eine Staatsgrenze zu gehen? Sollte so etwas nicht zur Normalität gehören? Zum ersten Mal begann ich zu begreifen, warum noch immer so viele Menschen die DDR verließen: Weil ihnen der Staat dieses Stück Normalität vorenthielt! Ich gehörte zu denen, die dem Staat dabei unterstützen. Jetzt nur nicht weiter denken! Verdammt, warum kann man Gedanken nicht einfach wie einen tropfenden Wasserhahn abstellen?
Der Oberleutnant lief lächelnd neben mir her. Obwohl er wohl ahnte, was in mir vorging? Ob es wohl sogar in seiner Absicht lag, mir diesen dringend benötigten Denkanstoß zu bieten? Ich werde es wohl nie erfahren, im Anschluss an die denkwürdigste Streife meines bisherigen Lebens trennten sich unsere Wege für immer!
Den Rest des Tages verbrachte ich grübelte ich weiter. Je mehr ich grübelte, desto sinnloser erschien mir der Dienst an der Grenze. Innerlich freute ich mich über den rotzfrechen Grenzübertritt. Gleichzeitig stellte ich mir die Frage, wie ich mich verhalten würde, wenn in diesem Moment jemand in Richtung Polen über die Gleise läuft. Nur, um einmal das Gefühl zu genießen, unerlaubt eine Grenze zu überschreiten. Noch gestern wäre mir die Antwort schnell über die Lippen gekommen. Nach diesem „Aha-Erlebnis“ war ich nicht mehr derselbe. Ich hatte endlich angefangen zu denken!
Am Abend kehrte ich, noch immer völlig unter dem Eindruck des Erlebten stehend, nach Hause zurück. Meine Frau versorgte gerade den Kleinen, als ich ins Wohnzimmer trat und mit glänzenden Augen verkündete: „Du glaubst gar nicht, wo ich heute war. In Polen!“, lieferte ich die Antwort gleich nach. Daraufhin blickte sie mich ungläubig an. „Wo bitte, warst du heute? In Polen?“ Statt Polen hätte ich auch Mond oder Mars sagen können. Für jemanden wie mich waren diese Planten so unerreichbar wie das Nachbarland. Voller Stolz erzählte ich ihr von meinem „Ausflug über die Grenze“. Ungläubig hörte mir meine Frau zu. „ Nicht das du deshalb noch Ärger bekommst“, befürchtete sie. Ich winkte ab und erwiderte „ das hat doch niemand gesehen.“
Ende Oktober erließ die Regierung der DDR eine Amnestie für alle wegen Verstoßes gegen den § 213 StGB inhaftierten. Gleichzeitig endeten damit die zunächst nur ausgesetzten verstärkten Überwachungsmaßnahmen an der Oder. Zur „Normalität“ kehrten wir deshalb noch lange nicht zurück.
Die Prophezeiung des Stasi-Offiziers
Gelangweilt saß ich nach dem Mittagessen in mein Dienstzimmer und breitete das kurz vorher in der Poststelle gekaufte Neue Deutschland auf dem Schreibtisch aus. Dialog hieß das neue Schlagwort. Egon Krenz, der neue Mann an der Spitze der DDR, zeigte sich gesprächsbereit. Dämlicherweise versuchte er der Öffentlichkeit zu suggerieren, dass die Initiative dazu ganz allein von der SED ausging. Genau das war aber nicht der Fall! Dennoch setzte ich alle Hoffnungen auf diesen Egon Krenz.
Hauptmann B. tuckerte auf seinem Dienst-Motorrad auf dem Hof der LPG. Ich räumte die Zeitung nicht weg. Warum auch? Politische Bildung gehörte schließlich zum Anforderungsprofil eines Volkspolizisten.
Kurze Zeit stapfte B., von Kopf bis Fuß in seiner grünen Lederkombi steckend, den unförmigen Schutzhelm in der rechten Hand haltend, ins Büro. Müde sah er aus, der Genosse Hauptmann. Schwungvoll legte er den Helm auf einen der Besucherstühle. Danach kramte er eine angefangene Schachtel „Cabinet“ aus der Innentasche. Wie immer bot er mir zuerst eine Zigarette an. Wie immer lehnte ich unter dem Hinweis, bereits seit drei Jahren Nichtraucher zu sein, die angebotene Kippe ab. B.s Besuche begannen stets nach demselben Ritual. Beim Anzünden der unvermeidlichen Zigarette geriet die aufgeschlagene Zeitung in seinen Blickwinkel. „Vorbildlich! Wie ich sehe, bereitest du gerade ein – Politaktuelles Gespräch – vor“, witzelte mein Gruppenpostenleiter. „Was hältst du eigentlich von Krenz?“ Ich überlegte einen Augenblick. Nicht, dass ich mich gegenüber Hauptmann B. hätte verbiegen müssen. Nein, wir pflegen untereinander einen offenen Umgangston. Aber B. legte keinen Wert auf vorschnelle Antworten. Vorsichtig formulierte ich: „Sagen wir es mal so: der Egon hat einen schweren Job übernommen, in einer schweren Zeit. Aber er ist der richtige Mann, wenn einer das Ruder wieder herumreißen kann, dann der Egon.“
Manfred B. winkte müde ab. „Meinst du?“ „Ja“, antwortete ich einigermaßen düpiert.
„Sonst hätte ich das ja wohl nicht gesagt.“
Hauptmann B. drückte die halb aufgerauchte Zigarette in dem bereitstehenden gläsernen Aschenbecher aus. Sekundenlang drehte er die Schachtel, bevor er sich eine neue Zigarette herausfingerte. Irgendetwas schien ihn sehr zu bedrücken. B. steckte die frische Kippe zwischen die Lippen, zündete sie an der Flamme seines Feuerzeugs an und sagte: „Ich hatte vorhin ein Gespräch mit Major Achim Ro.. Du kennst doch Achim Ro.?“ Was sollte die Frage? Wer im VPKA kannte den etwas korpulenten Stasi-Offizier von der Kreisdienstelle des MfS in Zernikow nicht? Ging er doch in der Seelower Mittelstraße ein und aus.
B. nahm einen tiefen Lungenzug. So tief, dass man fast meinen könnte, dass er den blauen Rauch bis in den Magen ziehen wollte. Nach einigem Zögern redete Hauptmann B. weiter: „Weißt du, ich bin mit dem Achim zusammen zur Schule gegangen. Da geht man vertrauensvoller um, als es die Dienstvorschrift erlaubt. Achim hat mir gesagt, dass die DDR am Ende ist. Die Karre steckt so tief in der Scheiße, die bekommt auch ein Egon Krenz nicht mehr heraus. Diese Entwicklung hat man in der Staatsicherheit schon seit Jahren kommen sehen. Dort war man längst der Meinung, dass, falls kein Wunder geschieht, die ganze DDR eines schönen Tages wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Dabei wurde die SED-Kreisleitung von der Staatssicherheit über die Missstände in Kenntnis gesetzte. Wahrscheinlich hat man im Kreml * die Berichte sofort ungelesen in den Papierkorb geschmissen. Nein, Uwe. Die DDR steht vor dem Untergang. Den niemand mehr aufhalten kann.“
Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen. Bislang hatte ich die Mitarbeiter der Staatssicherheit für „zweihundertprozentige Genossen“ gehalten, die in jeder Lebenslage fest an den Sieg des Sozialismus glaubten. Und nun erfahre ich aus dem Mund meines Vorgesetzten, dass in der Seelower Kreisdienststelle nicht anders als anderswo in der DDR gedacht und diskutiert wurde. Freilich hinter der berühmten „vorgehaltenen Hand“. Eine weitere unbekannte Gemeinsamkeit zwischen Volk und Staatssicherheit.
Wie zum Selbstschutz wehrte ich mich, B.s Worten. Glauben zu schenken. Wieder einmal erlebte ich, dass eine Illusion wie eine Seifenblase zerplatzte. So unglaublich es auch wieder klingen mag: in der DDR galt die Staatssicherheit bei einigen Mitbürgern im wahrsten Sinn als „Geheimtipp“. Wer sonst war in der Lage, Missstände zu ändern, wenn nicht der „zweitbeste Geheimdienst der Welt“? Jeder, der sich möglicherweise vertrauensvoll an das MfS wandte, wurde früher oder später bitter enttäuscht. Die offenbar doch nicht allmächtige Stasi nahm es tatenlos hin, dass die SED-Funktionäre ihre wohlformulierten Lageberichte einfach so in „die Tonne klopften.“
Wir besprachen dann noch ein paar unwichtige dienstliche Details. In Libbenichen war einer Dame vor dem Konsum das Fahrrad gestohlen worden, die Kriminalpolizei wünschte, dass ich in dieser Angelegenheit ermittle damit die Anzeige irgendwann zu den Akten gelegt werden konnte.
Im Anschluss sprach ich noch einmal die „Prophezeiung“ des Stasioffiziers an:
„Was soll denn werden, wenn die DDR untergeht?“ Manfred schaute mich traurig an.
Ratlos mit den Schultern zuckend sagte er: „Früher oder später wird es wohl zu einer Wiedervereinigung Deutschlands kommen. Nicht heute und auch nicht morgen. Aber in zwanzig Jahren könnte es durchaus so weit sein.“
In zwanzig Jahren werde ich fünfundvierzig Jahre alt sein, errechnete ich in Gedanken. Ein Mann im besten Alter. Über den Fortgang meiner beruflichen Karriere in einem dann geeinten Deutschland machte ich mir keine Illusionen. Die Wiedervereinigung Deutschlands war für mich gleichbedeutend mit dem Ende meines Polizistendaseins.
Das Telefon auf meinem Schreibtisch klingelte schrill und heftig. Oberstleutnant N. hatte mal wieder Sehnsucht nach seinen Abschnittsbevollmächtigten. Um 15:00 Uhr sollten wir uns einmal mehr im VPKA einfinden.
Bevor sich Manfred von mir verabschiedete, nahm er mir das Versprechen ab, über das soeben gehörte zu schweigen
Ich flüchtete mich in Zweckoptimismus. Woher sollte denn ausgerechnet ein „kleiner“ Stasimitarbeiter wissen, wie es mit der DDR weitergeht? Bei dem Gedanken fühlte ich mich schon wieder besser.
Die anstehende Versammlung brachte die nächste Hiobsbotschaft:
An N.s Standardformel von der sich ständig verschärfenden Lage hatte ich mich mittlerweile gewöhnt, der Vortrag unterschied sich nicht wesentlich von den anderen.
Bis auf diese Sätze: „Bei der gegenwärtigen Lageentwicklung kann auch eine komplette Öffnung der Staatsgrenzen zum Westen nicht mehr ausgeschlossen werden. Wenn wir kein Ventil öffnen, fliegt uns der Kessel demnächst um die Ohren.“
Wie bitte? So richtig einordnen konnte die Neuigkeit noch niemand. Die „Mauer“ war in unseren Augen so etwas wie ein Deich, der uns vor dem Eindringen des Meeres schütze. Eine Öffnung der Grenzen käme der Aufgabe der DDR gleich!
Im Anschluss an die Versammlung besuchte ich sofort Alois Fleischer, in dessen Haus in Sachsendorf. Der ehemalige ABV lechzte geradezu nach jeder noch so kleinen Information über die wahre Situation in der DDR.
„Erzähle schon, was gibt es Neues“, drängte er mich, während Frau Fleischer duftenden Kaffee servierte. „Was es Neues gibt? N. meint, dass demnächst die Mauer fällt“, gab ich zur Auskunft. Gerade glücklich sah ich dabei wohl nicht aus. Alois atmete geschockt durch den Mund ein und wieder aus. Wortlos zündete er sich eine Zigarette an. Worauf ihn seine Frau strafend ansah. Der Hausarzt hatte Alois dringend geraten, auf das ungesunde Laster zu verzichten, was ihm jetzt schwerer denn je fiel. „Wenn die Mauer fällt, dann kannst du als Polizist einpacken! Weißt du, was dann passiert? Drogen und Waffen werden ins Land kommen, jeder Strolch rennt dann mit einer Knarre rum. Wir können nur hoffen, dass das nicht passiert.“ Stumm nickend, pflichtete ich Alois bei. Westberlin lag nur gute achtzig Kilometer entfernt. Die „besondere politische Einheit“ galt uns als Sündenbabel schlechthin, vor dessen unangenehmen Begleiterscheinungen die“ Berliner Mauer“ bislang zuverlässig die DDR und deren Einwohner bewahrte, dass diese Mauer aber auch eine Großstadt und deren Bewohner von einander trennte, unendliches Leid verursacht hat, ja eigentlich überhaupt nicht in diese Welt passte, daran dachten wir in diesem Moment nicht.
Wie ich den Mauerfall verschlief
Wir schreiben den 10. November 1989. Die Welt draußen vor meinem Schlafzimmerfenster ist nicht mehr dieselbe wie noch am Abend zuvor. Davon ahne ich jedoch noch nichts.
In meinem Schädel werkelt ein Hammerwerk auf vollen Touren. Durch das Fenster fällt grelles Tageslicht ins Schlafzimmer. Mühsam versuche ich, die Augen zu öffnen. Schließe sie aber sofort wieder, da mir das Licht heftige Schmerzen bereitet. Ich versuche mich an den Ablauf des vergangenen Abends zu erinnern. Es gab da eine Feier. Auf der wie auf Feiern üblich, Alkohol getrunken wurde. Obwohl ich das Zeug eigentlich nicht vertrage, habe ich mir offenbar so richtig die Kante gegeben. Bruchstückhaft kehrt die Erinnerung zurück. Der Abend war alles andere als gemütlich gewesen. Eigentlich nur im Suff zu ertragen. Ich höre wieder die abfälligen Bemerkungen über SED, MfS und Volkspolizei. Aus dem Munde zweier Männer, die bis vor kurzem selbst Mitglieder der Einheitspartei waren. Heute aber so taten, als wären sie schon immer „dagegen gewesen“. „Die von der SED“, wie oft hatte ich diese drei Worte an diesem Abend wohl gehört? „Ihr habt doch auch dazugehört“, hatte ich irgendwann, schon ziemlich angetrunken, in den Raum geworfen. Worauf ich zum ersten Mal die später oft vernommene Standardantwort: „Wir haben dazu gehört, weil wir es eben mussten“, hörte.
Im Laufe dieser „Feier“ sah ich mich gezwungen, mehrfach das Zimmer zu verlassen. Anders hätte ich meinen Zorn nicht in den Griff bekommen! Da konnten selbst Radeberger Bier und „Goldbrand“ die ungeheure Wut nicht dämpfen. Im Moment des Untergangs wollte es wieder einmal keiner gewesen sein. Von wegen, Geschichte wiederholt sich nicht! Feigheit wurde zur Grundtugend stilisiert. „Christian Re. hat die Karre in den Dreck gefahren. Er soll gefälligst sehen, wie er sie wieder herausbekommt“, dieser im Kreis Seelow kolportierte Satz eines Lokalpolitikers, welcher öffentlich den Posten des „ Vorsitzenden des Rates des Kreises“ ablehnte, stieß bei den Feiernden auf Zustimmung. So ist es richtig! Meckern, sich das Maul zerreißen, aber bloß keine Verantwortung übernehmen. Lieber amüsiert man sich über die vergeblichen Bemühungen anderer. Es lag beileibe nicht nur am Alkohol, dass mir an diesem Abend zum Kotzen zumute war! Den Höhepunkt bildete die wohlwollende Zustimmung von Gewalttätigkeiten gegen Kinder von MfS-Mitarbeitern in einem Kindergarten bei Leipzig. Damals ging das Gerücht um, dass dort Erzieherinnen den Kindern die Hände verbrüht hätten! Auch wenn es sich tatsächlich nur um eine bewusst ausgestreute Unwahrheit handelte, schockierte mich die offen geäußerte Sympathie für derartige Widerwärtigkeiten, die sich gegen absolut unschuldige Kinder richteten.
Solcherart Zustimmung von bis vor kurzem noch von der Überlegenheit des Sozialismus überzeugten Mitbürgern wirkt geradezu zwangsläufig widerwärtig und verlogen!
Am nächsten Morgen wachte ich mit einem mordsmäßigen Brummschädel auf. Hatte ich Morgen gesagt? Die Zeiger der auf dem Nachtisch munter vor sich hin tickenden Weckuhr zeigten auf 10:55 Uhr! Ich hatte verschlafen. Zum ersten Mal in meiner Dienstzeit. Ruckartig erhob ich mich von den Kissen, mit dem Resultat, dass sich ein glühendes Messer durch mein Gehirn bohrte. Stöhnend sank ich aufs Kissen zurück. Meine Frau werkelte nebenan in der Küche. Ahnungsvoll bereitete ich mich auf das in solchen Lebenslagen unvermeidliche eheliche Donnerwetter vor. Neben dem Wecker steht ein uraltes Transistorradio, Made in USSR. Das mich schon während der langen Wartezeiten auf irgendwelchen Bahnhöfen, während der Lehrzeit und bei der Volkspolizei in Berlin Gesellschaft geleistet hatte. Gewissermaßen ein treuer Freund. Ohne die Augen öffnen zu müssen, fand ich den Einschaltknopf. Auf Rias II sangen die „Eurythmics“ von „Sweet Dreams“. Wie gerne hätte auch ich gerne wieder „süße Träume“ erlebt, statt von einem Alptraum in den anderen zu stolpern. Im Anschluss wurde eine Livereportage gesendet. Ein ungewöhnlich euphorisch klingender Reporter meldete sich direkt vom Kurfürstendamm. Inmitten nicht minder euphorischer Menschenmassen. „Ich nehme mal an, ihr kommt aus der DDR?“, fragte der Reporter. „Jaaaa“ , antworteten die Massen darauf. „Wie gefällt es euch in Westberlin?“ „Super“, schallte es über den Kudamm. Mein Gott, da werden wieder ein paar Botschaftsflüchtlinge vorgeführt, dachte ich und tastete nach der Senderwahltaste. „Könnt ihr euch vorstellen, dass die Grenze nun für immer aufbleibt?“ Automatisch zuckte meine Hand zurück. Was hatte der Reporter soeben gesagt? Ich drehte das Radio lauter.
„Natürlich bleibt die Mauer nun für immer offen“, äußerte eine dunkle Männerstimme im Brustton der Überzeugung. Jubelnd und klatschend pflichteten ihm die Umstehenden bei. Dann der Reporter: „Meine lieben Zuhörer: Vor gut zwölf Stunden hat die DDR ihre Grenzen zu Westberlin und zur Bundesrepublik geöffnet. Somit hat nach achtundzwanzig Jahren die Mauer ihren Schrecken verloren. Die Tage der Teilung Berlins sind somit gezählt. Ost und West liegen sich begeisert in den Armen. Neben mir auf der Fahrbahn, wälzt sich eine Karawane von Wartburg und Trabant den Kudamm entlang.“
Wie elektrisiert springe ich aus dem Bett. Spüre den Kater nicht einmal mehr. Richtig erfasst hatte ich die ungeheure Dimension des soeben gehörten noch immer nicht. Meine alkoholdurchfeuchteten Gehirnwindungen arbeiten auf Sparflamme. Mir war jedoch klar, dass sich in der Nacht dramatische Dinge abgespielt haben müssen. Wie hatte Oberstleutnant N. vor gut zwei Wochen orakelt:
„Bei der gegenwärtigen Lageentwicklung kann auch eine komplette Öffnung der Staatsgrenzen zum Westen nicht mehr ausgeschlossen werden. Wenn wir kein Ventil öffnen, fliegt uns der Kessel demnächst um die Ohren.“
An meiner Frau vorbei, eilte ich ins Wohnzimmer. Schaltete von atemloser Spannung erfüllt, den Fernseher ein. „Hast du mir nichts zu sagen? Schämst du dich nicht, dich so zu besaufen?“ Ich blieb ihr die Antwort darauf schuldig. Den wahren Grund hätte sie ohnehin nicht verstanden. „Erst den halben Tag verpennen und dann gleich Fernsehen schauen.“ Wieder ein Vorwurf, den ich mit den Worten: „die Mauer ist offen“, parierte. „Bist du immer noch besoffen?“ „Sieh doch selbst“, entgegnete ich und wies dabei auf den Bildschirm. Sekttrinkende, überglückliche Frauen und Männer standen oben auf der Mauerkrone. Sichtlich überforderte Grenzsoldaten bemühten sich unter dem Hohn und Spott der Massen, vergeblich die Feiernden vom „Allerheiligstes“ zu vertreiben. Auf der Westberliner Seite droschen kräftige Männerhände, mit Hilfe von Hammer und Meißel, auf die Mauer ein. Wie lange würden die Grenztruppen dem Treiben untätig zuschauen?
Die nächste Einstellung zeigte den Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße. Der von einem regelrechten Tsunami von Fußgängern und Fahrzeugen geradezu überrollt wurde. Autos hupten im Takt. Dazwischen immer wieder Jubelgesänge. Resignierte hilflose Passkontrolleure und Zöllner, schauten gesenkten Blickes, dem Treiben hilflos zu. Man kann wohl nur ahnen, was in den Köpfen der Männer in diesem Moment vorging. Ob sie wohl noch einen Sinn in ihrer Tätigkeit sahen? Hatte ihre Tätigkeit überhaupt je einen Sinn? Hin und wieder schüttelte jemand dankbar die Hände der Douaniers.
„Ich werde erstmal die Dienststelle anrufen“, sagte ich darauf zu meiner Frau. Die wie angewurzelt neben dem Fernseher verharrte. Um diese Zeit würde bei der Familie Wie niemand Zuhause sein. Das nächste Telefon befand sich einen Kilometer entfernt. In der Telefonzelle, an der Kreuzung. Frische Luft ist jetzt genau das richtige für mich. Ich lief die Frankfurter Straße entlang. Immer wieder rollten vollbesetzte Autos an mir vorbei. Ob die wohl alle nach Berlin wollten? Nach einem zehnminütigen Fußmarsch erreichte die Telefonzelle, in der es wie üblich nach kaltem Zigarettenrauch und Urin stank. Unterwegs hatte ich mir eine Ausrede für die verspätete Meldung überlegt. Eine Magenverstimmung sollte als Begründung herhalten. Was ja genaugenommen nicht völlig der Unwahrheit entsprach. Von einem unsagbar schlechten Gewissen gequält, wählte ich die Notrufnummer 110. Es dauerte einige Zeit, bis ich die Stimme des Operativen Diensthabenden vernahm. „Wenn du eine Magenverstimmung hast, dann trinke einen Pfefferminztee und lege dich ins Bett. Heute ist sowieso alles egal. Hier ist nämlich die Hölle los“, raunzte mich der Diensthabende an. „Warum das denn?“ Die naive Frage, brachte den Offizier gänzlich in Rage: „Warum das denn?“, höhnte er. „Junge, seid heute Nacht kann jeder in den Westen fahren. Der ganze Kreis Seelow steht vor der Tür des VPKA um sich ein Visum zu besorgen. Wenn du mir nicht glaubst, dann sieh dir das gefälligst selbst an.“ Ohne die Antwort abzuwarten, hatte der überreizte „ODH“ das Gespräch beendet. Mir wurde erneut schwindlig. Eine DDR ohne Mauer konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wie hatte Alois gesagt: „Wenn die Mauer fällt, dann kannst du hier als Polizist einpacken.“ Was aber wäre die Alternative gewesen? Das der Kessel DDR endgültig platzt? Wie so oft in diesen Herbsttagen, fiel mir keine Antwort ein.
Wieder Zuhause angekommen, duschte ich zunächst ausgiebig. Das kalte Wasser linderte zwar den Kater, nicht aber die quälenden Sorgen. War es das jetzt endgültig mit der DDR und dem Sozialismus?
Ungeachtet des sicherlich noch reichlich in meinem Blut vorhandenen Restalkohols, entschloss ich mich die vom „Operativen Diensthabenden“ geschilderte Situation, in Augenschein zu nehmen. Ungewöhnliche Ereignisse erfordern ungewöhnliche Maßnahmen!
Über die „Fernverkehrstraße 1“ fuhr ich der Kreisstadt entgegen. Wie schon in Manschnow herrschte auch hier ungewöhnlich viel Verkehr. Bereits von weitem, bei der Anfahrt von der Clara-Zetkin-Straße zum VPKA, fiel mir die endlos lange Menschenschlange vor dem VPKA auf. Just in dem Moment, direkt unter den Augen der Wartenden, setzte der Motor meiner „Schwalbe“ aus, so dass der Eindruck entstand, dass ich vor lauter Schreck über dem Anblick die Kontrolle verloren hätte. Ruckartig hüpfte das Gefährt unter dem schallenden Gelächter der Leute voran. Entnervt stellte ich das untreue Moped auf dem Parkplatz ab.
An der Sparkasse setzte sich der Auflauf fort, blockierte den gesamten Gehweg, zog sich am Gebäude der Staatsbank vorbei bis zur Einfahrt der Straße der Jugend. Unbegreiflicherweise zeigten sich die Leute gutgelaunt, niemand schimpfte über die lange Wartezeit, stattdessen bewegte ungeheure Freude über die urplötzlich hereingebrochene unverhoffte Reisefreiheit die Gemüter. Vom Puschkinplatz starrte ich auf die geduldig Zentimeter für Zentimeter vorwärtsbewegende Menge. Nach zehn Minuten der Erstarrung, ging ich zurück zum Parkplatz. Wenigstens sprang die „Schwalbe“ ohne weiteres an. Ich fuhr zunächst nach Dolgelin, das wie ausgestorben wirkte. Dann weiter zu meinem Lieblingsplatz hoch droben auf den Seelower Höhen. Das weite Oderbruch verbarg sich unter grauem Nebel. Trüber Dunst legte sich auch über meine Gedanken. Selbst in der ungestörten Einsamkeit der Natur, fand ich keine Antwort auf die Frage, wie es denn nun in der DDR weitergehen sollte.
Zum ersten Mal in Westberlin
Hätte mir vor vier Wochen jemand gesagt, dass ich am fünften Dezember 1989 zu einem Trip nach Westberlin aufbrechen würde, wäre ich wohl in Gelächter ausgebrochen. In der sich spätestens seit dem 9. November im schwindelerregenden Tempo verändernden DDR durften nun auch die Angehörigen der „Schutz und Sicherheitsorgane“ offiziell hinter die Mauer schauen. Das noch immer benötigte Visum hatte ich mir eines Abends ganz unproblematisch im Flur des VPKA besorgt. Dort war mittlerweile fast der gesamte Mitarbeiterbestand, inklusive des Politoffiziers, mit der Visa-Ausgabe beschäftigt. Seltsam unwirklich die Szenerie: im halbdunklen Flur, im Erdgeschoss, saßen Polizisten an einem Tisch und stempelten im Akkord Personalausweise ab.
Selbst anstellen brauchte sich kaum noch jemand, die Bürger gaben die Ausweise ganz einfach beim zuständigen ABV ab. Dieser fuhr dann nach Dienstschluss ins VPKA, um den begehrten Stempel zu besorgen.
Vorübergehend durften wir das seltene Gefühl auskosten, tatsächlich als Volkspolizisten von der Bevölkerung betrachtet zu werden.
Vier Tage vor meiner ersten „Westreise“ war ich, unter dem Eindruck der Ereignisse, aus tiefer Enttäuschung zu einem Teil jedoch auch dem Irrglauben folgend, der eigenen Vergangenheit entfliehen zu können, aus der SED ausgetreten. „Sei ehrlich, du willstt doch bloß später nach der Wiedervereinigung Beamter werden“, hatte der Parteisekretär meinen Schritt traurig lächelnd kommentiert. „Blödsinn“, erwiderte ich und fuhr zurück in mein Dienstzimmer. Dabei war mir echt zum Heulen zumute. Ich hatte einen Abschnitt meines Lebens hinter mir gelassen, mit dem sich so viele Hoffnungen, Verpflichtungen und Ideale verbanden. Von denen innerhalb kürzester Zeit nichts als einziger mentaler Trümmerhaufen übrig blieb.
In der Annahme, noch immer zu träumen, begaben wir uns am Morgen des 05. Dezember 1989 nach Seelow zum dortigen Busbahnhof. Von dort verkehrten Sonderbusse im Stundentakt zum S-Bahnhof Strausberg-Vorstadt. Dicht gedrängt, angeregt plaudernd, erwarten zahlreiche „Westreisende“ aus dem gesamten Kreisgebiet, die Abfahrt des Busses. Überall wo hin man schaute, herrschte eine ausgelassene Stimmung. So diszipliniert, wie nur DDR-Bürger sein können, stiegen die Wartenden in den bereitgestellten Bus. Über Diedersdorf-Müncheberg-Herzfelde-Hennickendorf, ging es zunächst nach Strausberg.
Dort erwartete uns der erste Schock: der Bahnsteig in Richtung Berlin zeigte sich von einem regelrechten Menschenmeer geradezu überflutet. Wer hier zu Boden stürzte, lief Gefahr erdrückt oder zertreten zu werden. Sichtlich gestresst, bemühten sich Reichsbahnangestellte, von ebenso überforderten Transportpolizisten unterstützt, wenigstens ein wenig Ordnung ins Chaos zu bringen. Unter dem Einsatz der Ellenbogen, tretend, drängelnd, schubsend, kämpften sich die Menge in das Innere der vorgefahrenen S-Bahn. Auf dem S-Bahnhof Strausberg war nichts mehr von der vielbeschworenen Disziplin zu spüren.
Die ersten beiden S-Bahnzüge fuhren ohne uns nach Berlin. Irgendwann hatten wir es ebenfalls geschafft. Vom enormen Druck der nachrückenden Menschen wurden wir regelrecht in das Innere eines S-Bahnabteils hineingedrückt. An einen Sitzplatz war natürlich nicht zu denken. Immerhin schaffte ich es, mich an einer Querstange klammern zu können. Hilflos eingequetscht, zwischen meiner Ehefrau und einem bierseligen Endfünfziger, sah ich anschließend die Landschaft vor dem Fenster an mir vorbeifliegen. Quälend langsam, in quälender Enge gefangen, näherten wir uns der Hauptstadt Berlin.
Neuenhagen, Hoppegarten, Mahlsdorf, in Gedanken hakte ich jede einzelne Station ab. Kaulsdorf, Biesdorf, Friedrichsfelde-Ost, endlich kam tauchte die Silhouette des Fernsehturms auf. Ostkreuz, Ostbahnhof, Alexanderplatz, noch immer verließ kaum jemand die überfüllten Abteile. Ein unangenehmes Gemisch aus menschlichen Ausdünstungen, kaltem Tabakqualm und dem Geruch von Bockwurst folterte die Atmung zusätzlich.
Aber irgendwann findet selbst die längste Reise ihr Ende! Gierig nach Sauerstoff schnappend, wie Fische auf dem Trockenen, verließen wir am Bahnhof Friedrich-Straße den „Horrorzug“. Ich sah mich kurz um. Vor zwei Jahren habe ich zuletzt hier gestanden, damals noch als Angehöriger des „Wachkommando Missionsschutz Berlin“, bei der Rückkehr von einem Einsatz vor der „Ständigen Vertretung der Bundesrepublik“, am Tag, als Erich Honecker den „Klassenfeind“ besuchte.
An den nach Westberlin führenden Gleisen stand ein mittlerweile verwaistes blechernes Postenhäuschen. Bis vor kurzem saß dort noch ein Grenzsoldat, der darauf achtete das ja kein Unbefugter in den Zug einsteigt. Mir blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. Weiter ging es zum Grenzübergang Friedrichstraße, dem so genannten Tränenpalast. Den ich bislang lediglich in gebührendem Abstand betrachten konnte. Vor dem Eingang des Grenzüberganges wartete eine Menschenschlange darauf, von dauerlächelnden Passkontrolleuren abgefertigt zu werden. Was in den Köpfen der Grenzer in Momenten wie diesen wohl so vor sich ging? Genaugenommen bestand ihr Job nicht mehr im Schutz der Staatsgrenze, sondern lediglich darin, dem glückstaumelnden DDR-Volk als lebende „Knuddelbärchen“ zu dienen. Unvorstellbar, dass es jemand von ihnen wagen würde, einem Bürger die Ausreise zu verweigern, selbst wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorgelegen hätten! Wen interessierten noch Gesetze, in einem lahmgelegten Staatsgefüge?
Lächelnd knallte ein Oberfähnrich, der einem mir aus meiner Armeezeit her bekannten Spieß verblüffend ähnlich sah, einen Stempel in den Ausweis.. Mich würde es nicht wundern, wenn man die gesamten Grenztruppen an die Übergangsstellen beorderte, da es an der „Linie“ ohnehin nichts mehr aufzupassen gab.
Jetzt ging es hinunter zur U-Bahn. Obwohl sich die U-Bahnstation hinter der Grenzpassage befand, gehörte sie dennoch zum Staatsgebiet der DDR. An den Wänden installierte Videokameras überwachten das Geschehen. Von hier aus setzte sich 1981 der Doppelagent Werner Stiller, von dem ich freilich 1989 noch nichts wusste, in den Westen ab.
Ob wohl vor den Bildschirmen, in der Überwachungszentrale noch immer jemand saß? Wir warteten auf die Abfahrt der U-Bahn. In welche Richtung? Das habe ich leider vergessen. Unser Ziel war der Hermann-Platz. Dieser wurde uns von vorhergehenden Westreisenden wärmstens empfohlen. Dann fuhr die U-Bahn ein. Abfahrt durch die Berliner Unterwelt.
„Ob wir jetzt im Westen sind?“, fragte meine Frau leise. „Na klar“, antwortete ich ebenso leise. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich einen jener legendären „Geisterbahnhöfe“, nach dem Mauerbau stillgelegte, dennoch weiter von Transportpolizei und Grenztruppen bewachte U-Bahnstationen, auf denen die Zeit im August 1961 stehengeblieben schien.
An Litfaßsäulen und der braun gekachelten Wand hingen selbst noch die Veranstaltung- und Werbeplakate aus der Zeit kurz vor dem Mauerbau. Clown Ferdinand, viel zu große Schuhe an den Füßen, die rote Nase leuchtend im Gesicht, grinste mich von einem der Plakate an. Unmerklich schüttelte ich den Kopf.
Nach einigen Minuten verließ der Zug die Unterwelt. Vor mir sah ich in einiger Entfernung die Berliner Mauer. Die an dieser Stelle noch so intakt wie eh und je erschien. Dahinter erhob sich das Reichstagsgebäude. Kein Zweifel mehr, jetzt befanden wir uns tatsächlich im Westen! Spontan kam mir eine Begebenheit aus dem Jahre 1986 in den Sinn. Damals war ich, unweit von hier, auf der anderen Seite der Mauer, eingesetzt. Und zwar in der so genannten „Wache Mitte“ des Missionsschutzes. Der Innenhof der Wache stieß unmittelbar an die Hinterlandsmauer, hundertfünfzig Meter Luftlinie vom Reichstagsgebäude entfernt.
Zu den Aufgaben eines „WKM-Posten“ gehörte nicht nur der Schutz von Botschaften und Residenzen, sondern auch die Bewachung des eigenen Objektes. Einen kühlen, windigen Märznachmittages streifte ich gemeinsam mit einem gleichaltrigen Hauptwachtmeister über den Innenhof. Dabei hörten wir, jenseits der Mauer, immer wieder das klopfende Geräusch der im Sturmwind flatternden Fahne, welche sich auf dem Dach des Reichstagsgebäude befindet. Das klopfende Geräusch der Fahne erschien uns wie ein Signal aus einer fernen unerreichbaren Welt. So ähnlich musste sich wohl ein Sternenforscher fühlen, wenn er in seinem Fernrohr das Licht von Millionen Kilometer entfernten Himmelskörpern erblickt.
„Was meinst du, ob wir den Reichstag auch mal von Nahen sehen können“, wurde ich von meinem Kollegen gefragt. „Wer weiß?“, antwortete ich zögerlich, „vielleicht wenn wir Rentner sind? Aber ob wir als Volkspolizisten überhaupt in den Westen fahren dürfen?“
„Von der Rente trennen uns aber beinahe noch vierzig Jahre“, sinnierte der Hauptwachtmeister. „ Das ist nun einmal so“, beendete ich die fruchtlose Diskussion. Ohne zu ahnen, dass nicht einmal vier Jahre bis zu meiner ersten Westreise ins Land gehen sollten.
Vom Fenster aus hatte man einen wunderbaren Blick auf die Grenzanlagen. Beobachtungstürme, Führungsstellen, Signalzaun, so als hätte den 09.November 1989 nie gegeben. Ob dort noch jemand aufpasste?
An irgendeinem Bahnhof stiegen wir in einen von bunten Graffitis „verzierten“ S-Bahn-Zug ein, der uns zum Hermannplatz brachte. Förmlich an der Scheibe klebend, wie im Trance, sog ich die mir völlig fremde Welt dort draußen in mir auf. In den Himmel ragende Hochhäuser, vorbeifahrende Nobelkarossen und immer wieder Graffitis die aussahen, als wären sie im LSD-Rausch entstanden.
So wie es aussah, waren wir nicht die einzigen DDR-Bürger im Abteil. Unterschied sich diese spezielle, in vierzig Jahren Sozialismus entstandene Spezies recht deutlich von den Einheimischen. DDR-Bürger erkannt man in diesen Tagen nicht nur an der Kleidung oder am Habitus, sondern vor allem daran, wie sie sich über heute als völlig profan empfundene Dinge begeisterten.
Am Hermannplatz angekommen, führte uns der erste Weg zu einer der zahlreichen Auszahlstellen für das begehrte „Begrüßungsgeld“. 100 Deutsche Mark, für die meisten eine unvorstellbare große Summe an harten Devisen, spendierte der Westberliner Senat jedem Besucher. Zuvor hieß es erst einmal anstehen und warten. Aber daran hatten wir uns ja längst gewöhnt!
Aus den Händen einer bebrillten, professionell freundlichen Dame, erhielt ich das Begrüßungsgeld. Ein Stempel im Personalausweis quittierte den einmaligen Empfang.
Dem Herdentrieb folgend, steuerten wir das riesige „Woolworth-Kaufhaus“ an. Südländisch aussehende Frauen und Männer boten in Verkaufsständen Obst und Gemüse an. Tomaten, Äpfel, Bananen, Melonen, Weintrauben, Gurken und Kürbisse.
Jeder einzelne Stand verfügte über ein größeres Sortiment als die Ostberliner Markthalle. Trotz aller Verlockung: wer möchte sein kostbares Westgeld schon für „Grünzeug“ ausgeben.
– Zwischen Bullenhelm und Nasenbein/ passt immer noch ein Pflasterstein“, stand in Großbuchstaben auf eine Wand geschrieben. Niemand schien diese offen zur Gewalt gegen Polizisten aufrufende Parole zu interessieren. Aus einem Lautsprecher, vor dem Kaufhaus, dudelte Weihnachtsmusik. Mein Herz raste. Ich fühlte mich erwartungsvoll wie ein Kind.
Beim Betreten des kapitalistischen Konsumtempels „Woolworth“. Unstet nach vorn schauende Frauen und Männer, pralle Plastiktüten in den Händen haltend, strömten ins Freie. Während wir in die entgegengesetzte Richtung strebten. Hinein in die erst beste Verkaufsabteilung. Den Mund weit aufgerissen, geblendet von dem schieren Überangebot an Waren, blieb ich auf der Stelle stehen. Nie zuvor war mir die Bedeutung der Metapher „die Qual der Wahl“ deutlicher bewusst geworden. Nicht nur meine Augen, auch die anderen Sinnesorgane zeigten sich in Folge der absoluten Reizüberflutung heillos überfordert. Bislang lediglich aus der „Westwerbung“ her bekannte Produkte lagen zum Greifen nahe. Ein mir völlig unbekanntes, angenehmes Geruchsgemisch schmeichelte meiner Nase. Während mich leise Musik geradezu einlullte. So als wenn wir von einer Epoche in die andere geraten wären, torkelten wir durch die Gänge des Kaufhauses. Ohne uns für eine der vielen verlockenden Waren entscheiden zu können. Den hinter jeder Ecke lauerte noch etwas Besseres, schöneres, Bunteres. Dann entdeckte ich ein Zeitungsregal. „Wiener“, „Stern“, „Spiegel“ und so weiter und so weiter. Neugierig schlug ich ein Exemplar der „BILD-Zeitung“, dem verfemten Sprachrohr des Klassenfeindes, auf. – „STASI – deine Zeit ist um“, lautete die Schlagzeile auf der Titelseite. Erregt las ich von der Erstürmung und Besetzung des Leipziger „Bezirksamtes für Nationale Sicherheit“, dass das DDR-Volk im gesamten Land zur Offensive gegen die verhasste Staatssicherheit geblasen hat“ Des Weiteren mutmaßte die Zeitung, „dass die bislang friedlichen Veränderungen im Land nun doch in Gewalt umschlagen könnten.“
Verdammt, schoss es mir durch den Kopf, schere dich zurück nach Hause! Wer weiß, ob ich nicht vielleicht gerade dringend in Seelow gebraucht werde? Aber sollte ich meiner Frau den Tag verderben? Wegen einer bloßen Annahme? Nein!
Nach drei Stunden kehrten wir aus dem Konsumtempel zurück ins Freie. Ich hatte mir ein paar Zeitschriften und drei Musikkassetten gegönnt. Und meine Frau eine Flasche Parfüm und einen schicken Pullover.
Draußen entdeckten wir einen kleineren Laden zu dessen Angebot unter anderem Wegwerfplastikwindeln der Marke „Pampers“ gehörten. Immer und immer wieder fixierte meine Frau die Packung. Die Aussicht, für eine geraume Zeit nicht mehr die benutzten Stoffwindeln unseres Sohnes waschen zu müssen, erschien äußerst verlockend. Verständlicherweise, konnte man doch benutze“ Pampers“ einfach entsorgen, statt zu waschen. Einzig der Preis, zwanzig wertvolle D-Mark, erschien mir viel zu hoch. Minuten vergingen, in denen wir, ohne ein Ergebnis zu erlangen, auf dem Gang herumstanden, immer wieder das Für und wider abwägend.
„Packen Sie die Windeln ein. Ich übernehme die Bezahlung“, ertönte plötzlich eine Stimme aus dem Hintergrund. Die Stimme gehörte einem unscheinbaren, schmächtigen älteren ungefähr sechzig Jahre alten Westberliner. Höflich aber bestimmt lehnte ich ab.
Sichtlich enttäuscht flehte uns der nicht gerade wohlhabend ausschauende Mann an: „
Bitte, machen Sie mir doch die Freude. Ich warte schon die ganze Zeit auf eine Gelegenheit, den Freunden aus der DDR etwas Gutes tun zu dürfen“, flehte er mich geradezu an.
Mit dem weiblichen Wesen offenbar in die Wiege gelegten Pragmatismus, nahm meine bessere Hälfte das Angebot ohne weiteres Zögern an. Während ich mich unendlich schämte. Nicht wegen meiner „gierigen“ Frau und auch nicht wegen des Gefühls, „Almosen anzunehmen“, sondern, weil ich zu feige war, dem Mann zu sagen, dass ich sein Angebot überhaupt nicht verdient hatte! Hätte er gewusst, dass ich bei der Volkspolizei bin und bis vor kurzem noch der SED angehörte, wäre er wohl kaum so freigiebig gewesen.
Strahlend vor Glück ging er zur Kasse, bezahlte den Obolus und wünschte uns anschließend noch einen schönen Aufenthalt in Westberlin. Ich kam mir dagegen vor wie ein mieser Betrüger!
Knurrend meldete der Magen sein natürliches Recht an. Magisch angelockt vom Duft frischen Fladenbrotes, pilgerte ich zu einem Imbissstand, hinter dem ein schnauzbärtiger Türke mittels eines großen Messers Fleischstücken von einer Rolle säbelte, anschließend in einen aufgeschnittenen Fladen packte, jede Menge Gurken, Tomaten und Zwiebeln dazugab, und das Produkt an bereits ungeduldig wartende Kunden verkaufte. Döner Kebab hieß diese „Fleischbombe“. Schon allein bei dem Namen lief mir das Wasser im Munde zusammen.
Während wir uns den Genüssen hingaben, näherte sich plötzlich ein einzelner Streifenpolizist. Lässig, die Arme auf dem Rücken verschränkt, streifte er über den Platz. In der Tasche seiner grünen Uniformjacke steckte ein Handfunksprechgerät. Kleiner und sicher auch leistungsfähiger als die von der VP verwendeten Geräte.
Beim Vorbeigehen vernahm ich ein lautes Stimmengewirr aus dem Lautsprecher des Funkgerätes. „Guck mal, da läuft ein Kollege von dir“, nuschelte meine Frau mit vollem Mund. Ich nickte ihr zu, zweifelte aber daran, dass mich der Westberliner Schutzmann als Kollegen ansehen würde.
Irgendwann am späten Nachmittag hatten wir die Schnauze voll von Westberlin. Auf dem Weg zum S-Bahnhof fiel mir wieder eine unübersehbare Menschenschlange auf. Direkt vor einem Einkaufsmarkt mit dem Namen ALDI. Nie gehört, dachte ich hundemüde.
Zurück im „Tränenpalast“, der diesen Beinamen nun nicht mehr verdiente, wurden wir von unvermindert freundlichen Grenzern und Zöllnern wieder in der DDR willkommen geheißen. Wir fühlten uns wie in einem „Since-Fiction-Film“
: man tritt durch eine Tür und gelangt von einer Welt in die andere. Aus der hochmodernen Glitzerwelt des Westens in den eher grauen Osten. Der mir trotz allem, oder gerade deswegen, vertraut und heimatlich erschien.
„Haben Sie etwas zu verzollen?“, wurden wir von einem blauuniformierten Zöllner gefragt. „Nein, wir haben nur ein paar Mitbringsel im Gepäck. Musikkassetten, Anziehsachen und ein paar Zeitungen“, antwortete ich brav. „Dann wünsche ich ihnen noch einen Guten Abend“, erwiderte der Douanier und widmete sich dem nächsten Reisenden. Wenige Wochen zuvor wären die Zeitungen gnadenlos konfisziert worden. Heute kümmert sich kein Mensch mehr um eingeführtes westliches Gedankengut.
Die Rückreise gestaltete sich ähnlich anstrengend wie die Hinreise zuvor. Mehrere Transportpolizisten hielten die Zugänge zu den bereits völlig überfüllten Bahnsteigen besetzt.
Endlich fuhr die in Richtung Strausberg verkehrende S-Bahn ein. Der Bahnsteig begann sich wieder zu leeren. Ein Teil der Wartendenden durfte endlich die Sperre der Transportpolizei passieren. Murrend und schimpfend drängelten sich die schwerbeladenen Heimkehrer an den entnervten Polizisten vorbei. Glücklich ergatterten wir einen Stehplatz. Müde und erschlagen langten wir gegen 20:00 Uhr wieder Zuhause an. Schlaf fand ich in dieser Nacht dennoch kaum. Verdammt, wie hat man uns verarscht, dachte ich voller Wut. Immer wieder sah ich das Gesicht des freundlichen Westberliners vor mir, der ohne es je zu erfahren, einen staatstreuen „Büttel“ beschenkt hatte. Ich schäme mich noch heute dafür, dem Mann nicht einfach die Wahrheit gesagt zu haben.
Ich drehte mich auf die andere Seite, grübelte darüber nach, ob die DDR überhaupt noch eine Chance hat das Jahr 2000 „zu erleben“. Ohne eine Antwort zu finden, fiel ich irgendwann in einen unruhigen, von wirren Träumen dominierten Halbschlaf.
Die in jeder Hinsicht letzte Parteiversammlung des VPKA Seelow

Am 11. Dezember rief mich die Kaderleiterin in meinem Dienstzimmer an:
„Heute ab um 17:00 Uhr findet eine außerordentliche Parteiversammlung für die gesamte Belegschaft des VPKA statt, wegen der zu erwartenden hohen Teilnehmerzahl müssen wir auf den Versammlungsraum des Rates des Kreises ausweichen.“ „Ich bin kein Mitglied der Partei mehr“, erwiderte ich trotzig. „Keine Widerrede, du kommst!“, stellte Hauptmann Rei. unmissverständlich klar. „Es geht nicht mehr um die Partei, sondern um die Zukunft jeden einzelnen Mitarbeiters.“
Ich willigte ein. Die eindringlichen Worte der besorgten Kaderleiterin hallten noch lange in meinem Innern nach. Noch gelang es mir, die immer wieder aufsteigenden diffusen Ängste zur Seite zu schieben.
Kurz vor 17:00 Uhr traf ich auf dem Parkplatz vor dem VPKA ein. Das graue nasskalte Wetter passte zur trüben Stimmung. Zum zweiten Mal in diesem Jahr betrat ich den großen Schulungsraum der Kreisverwaltung. Wenigstens brauchte ich heute kein Papier bewachen, dachte ich einem Anflug von Sarkasmus.
Wie von Hauptmann Rei. gefordert, waren tatsächlich fast die gesamten Abteilungen des VPKA, inklusive der Zivilangestellten, zur Versammlung erschienen.
Ich schaute in vertraute, ungewohnt ernste Gesichter. Mir wurde unwillkürlich mulmig. Tiefe Beklemmung breitete sich aus. Bei einigen Mitarbeitern herrschte bereits Untergangsstimmung.
Hauptmann Rei. eröffnete die Parteiversammlung. Zunächst übergab sie das Wort an den als Gastredner eingeladenen Eberhard St. von der LPG Alt Zeschdorf. St., der als Abgeordneter am Sonderparteitag der SED teilnahm, hatte schier Unglaubliches zu berichten:
Egon Krenz, vor kurzem noch der mächtigste Mann der DDR, nun zum gewöhnlichen Abgeordneten degradiert, sah sich gezwungen die Tagung von einem der hinteren Plätze aus zu verfolgen. Als er dann, während einer der Pausen, in gewohnter Weise den anwesenden Journalisten Interviews geben wollte, zog sich der „gestürzte König“ den Unmut der Genossen zu:
„Statt Statements abzuliefern, sollte sich der Abgeordnete Krenz lieber kritisch mit seiner Rolle in der Vergangenheit auseinandersetzen“, musste er sich von einem erregten Abgeordneten anhören.
Dann erzählte St. von einem weiteren, vor wenigen Wochen in der DDR, schier unglaublichen Vorfall:
Am Rande der Tagung wurden ganz offiziell Bücher verkauft. An sich nichts Ungewöhnliches, wenn sich diese Bücher nicht mit dem Tabuthema „deutsche Wiedervereinigung und deren absolute Unausweichlichkeit“ beschäftigt hätten. „Ich habe mir auch ein Exemplar gekauft“, räumte St. hintersinnig schmunzelnd ein. „Sehr interessant, was der Autor schreibt. Oh je, vor ein paar Wochen wäre ich dafür wohl sofort verhaftet worden“, flachste der Gastredner augenzwinkernd. Für diese Einlage erntete er von den Zuhörern gequältes Gelächter.
Aus dem Munde des Gastredners erfuhren wir, warum sich die SED nicht wie erwartet, aufgelöst hatte:
Weil die Gefahr eines Machtvakuums bestand. Und man nicht riskieren wollte, dass die sich bereits in Lauerstellung befindlichen Neonazis dieses Vakuum auffüllten. Stand die DDR also kurz vor der Machtergreifung des Faschismus? So jedenfalls wurde es uns in diesen Tagen jedenfalls suggeriert. In Wahrheit wäre die zwar durchaus vorhandene, jedoch zahlenmäßig relativ schwache, obendrein unorganisierte Neonazi-Szene kaum in der Lage gewesen, auch nur einen Kreistag zu besetzen.
Im Anschluss berichtete Frau Hauptmann Rei. von ihrem Gespräch mit Gregor Gysi, dem neuen Vorsitzenden der SED. Die von nun an den verpflichtenden Zusatz „Partei des demokratischen Sozialismus“ im Namen führte.
Hauptmann Rei. malte die Zukunft in den düsteren Farben.
„Wenn es uns in den kommenden Monaten nicht gelingen sollte, die Initiative zurückzuerlangen, ist es mit dem Sozialismus und der DDR schneller vorbei, als wir es uns heute schon vorstellen können.“ Dann kam der Satz, der wohl nicht nur mir einen schmerzhaften Hieb versetzte: „Und es sollte keiner denken, dass er dann nicht arbeitslos werden würde.“
Verhaltenes Gemurmel drang von den Nachbartischen her an mein Ohr. Zukunftsangst, ein bislang unbekanntes Gefühl, breitete sich wie ein Gespenst unter den Volkspolizisten und Zivilangestellten aus.
Die anschließende Diskussionsrunde geriet zu einer emotionsgeladenen Abrechnung mit der Führung des Volkspolizeikreisamtes:
Ein ungewohnt zerknirschter Oberstleutnant N. berichtete von immer neuen Fällen von Machtmissbrauch in der DDR. „So wie es aussieht, hat uns die Partei jahrelang hinters Licht geführt“, sagte der sichtlich ratlose Offizier.
„Können Sie mir sagen, was ich einmal meinen Kindern erzählen soll, wenn sie mich nach meiner Rolle in der DDR fragen?“, schleuderte eine Zivilangestellte der Abteilung „Pass & Meldewesen“ dem ratlosen Amtsleiter entgegen.
Ungleich heftiger geriet der Auftritt der Meldestellenleiterin, Leutnant Petra K.
Die resolute Frau rekapitulierte noch einmal die Monate von August bis Oktober:
„Zu den Aufgaben der Meldestelle gehört es, Reiseanträge in sozialistische Staaten entgegenzunehmen, unter anderem nach Ungarn. Normalerweise wurde das benötigte Visum schnell erteilt. Dann kam Mitte September die Anweisung, dass Reisen nach Ungarn denen ins NSW gleichgestellt sind. Das hatte zur Folge, dass erst umfangreiche Überprüfungen in Gang gesetzt wurden, in deren Folge einem Großteil der Antragsteller die sicher geglaubte Genehmigung verweigert wurde. Nicht von den Damen der Abteilung Pass & Meldewesen. Wohl aber von deren Leiter, Hauptmann Heinz H. und der Staatssicherheit. Was glaubt ihr, was wir uns von den Leuten anhören durften, als wir ihnen mitteilen mussten, dass sie ihren Urlaub in diesem Jahr nicht wie gewohnt am Balaton verbringen dürfen. Meine Mitarbeiterinnen und ich, wir haben den ganzen Hass und die Wut abgekommen. Wir mussten unseren Buckel für Dinge hinhalten, die ganz andere verzapft haben.“
Leutnant K. legte eine knappe Pause ein, ehe sie verbalen Rundumschlag ausholte:
„ Von der Führung bekamen wir keinerlei Unterstützung.“ Petra K. wies mit dem Zeigefinger auf den zusammengesunken, wie ein Häufchen Elend auf dem Stuhl hockenden Major Bie.: „Wo war er denn, unser feiner Politoffizier? In seinem Büro eingeschlossen hat er sich, damit ihm auch ja niemand stört.“
Wie von einer unsichtbaren Feder getroffen, schnellte der korpulente Major von der gepolsterten Sitzfläche seines Stuhls in die Höhe. Um Fassung ringend, hektisch mit den Armen rudernd, stammelte er: „Ich habe doch daran geglaubt, was Hager, Honecker oder Krenz über die Lage in der DDR gesagt haben. Ich habe doch gedacht, dass das alles wahr wäre, was die führenden Genossen sagen. Ich……“
Das weitere ging in einem heftigen Schluchzen unter. Peinlich berührt von dem unerwarteten Gefühlsausbruch, senkte Leutnant K. den Kopf. Konnte es ein deutlicheres Symbol für den aktuellen Zustand, in dem wir uns befanden geben, als ein verzweifelter, weinender Politoffizier?
Später hatte ich Gelegenheit, Artur Bie. in den wenigen Jahren, die ihm nach der Wiedervereinigung in den Reihen der Brandenburger Landespolizei vergönnt waren, als einen wirklich feinen Kerl kennenzulernen, der seine Vergangenheit eben nicht wie einen zu eng gewordenen Mantel abstreifte. Während den Wendewirren erwies sich der gutmütige Major jedoch in der Rolle des Politoffiziers als Fehlbesetzung. Beileibe nicht die einzige in jener Zeit! Ohne Anweisung von oben, eigenverantwortlich zu entscheiden, wurde nun einmal auf keiner Offiziersschule der DDR gelernt.
Als sich ein Unterleutnant zu Wort meldete und über die erlittenen persönlichen Einschränkungen der Vergangenheit schwadronierte, drohte die Versammlung endgültig ins Groteske abzugleiten. „Wir dürfen ja nun schon seit Anfang dieses Jahres Westfernsehen empfangen. Aber mal ehrlich, mich haben die ganzen Verbote ohnehin nicht gestört. ARD und ZDF habe ich schon seit Jahren empfangen.“
Da wollte sich wohl jemand klammheimlich als Widerstandskämpfer präsentieren? Aber er hatte nicht mit dem Erinnerungsvermögen von VP-Obermeisterin Gerda R., der Sekretärin des Amtsleiters, gerechnet:
„Jetzt reicht es mir aber“, schrie sie zornesrot dem Unterleutnant ins Gesicht, „Ob erlaubt, oder nicht, ich werde auch weiterhin kein Westfernsehen anschauen. Das sollte wohl für jeden Genossen Ehrensache sein! Waren das nicht deine Worte damals? Hast du sie etwa schon vergessen?“
Beschämt, unter dem Gelächter der anderen, nahm der Unterleutnant wieder Platz auf seinem Stuhl.
Und dann gab es da noch einen Verkehrspolizisten, der die Versammlung für seine ganz persönliche Abrechnung nutzte:
„Ich habe schon zweimal meine Kündigung eingereicht. Wenn ihr mir sagt, dass ich endlich die Uniform ausziehen kann, gehe ich sogar in Unterhosen hier raus.“
Der besagte Verkehrspolizist hatte die Schnauze voll, jedoch nicht erst seit den Wendentagen. Er fiel eigentlich schon immer mehr durch Meckern und Nörgeln als durch dienstliche Leistungen auf.
Seit längerem umgab ihn ein „dunkles Geheimnis“:
In einer dunklen Samstagnacht, im Jahre 1987, war er vom zuständigen ABV und einem weiteren Verkehrspolizisten aus dem heimischen Bett gezerrt worden.
Weil er, unter Alkohol stehend, einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt haben soll. Fakt ist, dass der Verkehrspolizist seinen „Trabant“ in die Garage gefahren hat, den seine Freundin zuvor vor dem Grundstück, im öffentlichen Verkehrsraum, geparkt hatte. Die Trunkenheitsfahrt betrug zwar nur wenige Meter, de facto handelte sich dennoch um eine Trunkenheitsfahrt. Wer die VP darüber informierte, wurde nicht bekannt. Der Verkehrspolizist fühlte sich anschließend als Opfer, seine ohnehin mangelnde Dienstauffassung sank endgültig „ gen Null“. Die Wendewirren nutzend, quittierte er noch vor dem Ende des Jahres 1989 endgültig den Dienst. Ein Opfer war er dennoch nicht. Höchstens ein Opfer seiner selbst!
In meinem Inneren fühlte ich eine unbeschreibliche Leere. Alles, an das ich geglaubt hatte, brach vor meinen Augen wie ein Kartenhaus zusammen.
Offenbar gab es noch immer Offiziere, die weiter unbeirrt den alten Kurs einschlugen: „Demnächst wird sich die Volkspolizei auch für die Mitglieder der Blockparteien öffnen“, verkündete Oberstleutnant N.., nicht ohne hinzuzufügen: „aber wir müssen diese Leute ja nicht unbedingt rufen.“
Immerhin verband sich mit der avisierten Änderung der Einstellungsbedingungen die Erkenntnis, dass es zukünftig keinen Politoffizier mehr in der Volkspolizei geben wird.
„Wenn es einen Politoffizier für die SED-Mitglieder gibt, dann wollen am Ende die CDU oder LDPD-Mitglieder auch einen“, begründete N. den Wegfall eines bis vor kurzem noch wichtigsten Dienstpostens innerhalb des VPKA.
Gegen 19:00 Uhr endete die letzte Parteiversammlung in der zu Ende gehenden Geschichte des Volkspolizeikreisamtes Seelow. Benommen schwankte ich nach draußen. Mittlerweile hatte einsetzender Frost Fahrbahn und Gehwege in tückische Rutschbahnen verwandelt.
Auch das noch, fluchte ich im Stillen. Die Füße fast auf dem Boden, tuckerte ich die Clara-Zetkin-Straße hinab. In Höhe des Ehrenmals geriet mein Moped ins Rutschen. Auf Grund der geringen Geschwindigkeit ging der Sturz für Mensch und Fahrzeug glimpflich aus. Dennoch steigerte der kleine Unfall die depressive Stimmung noch zusätzlich. Was sollte ich nachher meiner Frau erzählen, grübelte ich. Etwa das ich möglicherweise in den kommenden Monaten arbeitslos werde?
Verdammt und dabei hatte dieses Jahr 1989 so hoffnungsvoll begonnen!
Das Ende der Stasi
Die Besetzung der Leipziger Bezirkszentrale des „Amtes für Nationale Sicherheit“, wirkte wie ein DDR-weites Fanal. Fast überall in der Republik wurden die lokalen Dienststellen des „Geheimdienstes“ von „Bürgerbewegten“ in Beschlag genommen.
Ging es dort zunächst lediglich um die Verhinderung weiterer Aktenvernichtung und dem Sichern möglicher Beweise für vermutete oder tatsächliche Sauereien, war das Schicksal der „Kreisämter“ nach dem zehnten Dezember endgültig entschieden. Diese Dienststellen sollten ersatzlos aufgelöst und die Mitarbeiter entlassen werden.
Zu den konkreten Geschehnissen rund um das „Kreisamt für Nationale Sicherheit Seelow“ kann ich aus eigenem Erleben leider nicht viel beitragen.
Durch im „Neuen Tag“ erschienene diesbezügliche Artikel und Gespräche mit Kollegen sind mir die Abläufe im Wesentlichen bekannt:
Bereits im Vorfeld des landesweiten „Sturms auf die Staatssicherheit“, herrschte in der Seelower „Filiale“ ein Schwebezustand zwischen Frustration und nackter Überlebensangst. Mehr als einmal gingen im VPKA in den Nächten besorgte Anrufe aus dem Kreisamt ein, weil von in der Nähe des Objektes abgestellten Fahrzeugen aus die Dienststelle stundenlang beobachtet wurde.
Die Streifenwagenbesatzung kontrollierte die „Observanten“, nahm vielleicht hin und wieder die Personalien auf, hielt sich aber ansonsten besser zurück. Keiner wollte in den Verdacht geraten, Sympathien für die mehr und mehr in Verruf geratene „Stasi“ zu hegen.
Überhaupt hatte sich das vormals relativ enge Verhältnis zwischen VPKA und Kreisdienststelle bzw. Kreisamt für Nationale Sicherheit seit Mitte November empfindlich abgekühlt. Spätestens, seitdem Oberstleutnant N. im Rahmen einer Dienstversammlung den überraschten Volkspolizisten verkündet hatte, dass die in – Kreisamt für Nationale Sicherheit umbenannte Kreisdienststelle- ab sofort nicht mehr den täglichen Rapport des VPKA Seelow erhalten würde.
Gleichzeitig verbot den N. den Mitarbeitern der „Firma“ den Zugang zur Kreismeldekartei. Ein paar Wochen zuvor hätte sich der „aufmüpfige“ Oberstleutnant für diese Unbotmäßigkeit im Getränkelager der Seelower Konsumkaufhalle wiedergefunden!

Oberstleutnant N. setzte noch einen drauf: Eines Tages erschienen mehrere akut von Reduzierung bedrohte Mitarbeiter des „Kreisamtes für Nationale Sicherheit“ im Büro des VPKA-Leiters. Um sich vorsorglich nach den Möglichkeiten einer eventuellen Verwendung in den Reihen der Volkspolizei zu erkundigen. N. , offenbar über Nacht zum lupenreinen Demokraten mutiert, verwies die verzweifelten MfS-Mitarbeiter kurzerhand der Dienststelle.
Der Oberstleutnant kommentierte den Vorgang später vor versammelter Belegschaft mit den Worten:
„Ich lasse mir von denen doch nicht meine Polizei versauen!“
Der selbst in den Fokus öffentlicher Kritik geratene Amtsleiter schlug mit diesem „Schachzug“ gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen konnte er sich durch solche rigorosen Maßnahmen gegen die ohnehin in der Bevölkerung verhasste Staatssicherheit Sympathien erschleichen. Zum anderen zog er damit das VPKA selbst aus der Schusslinie.
Wie bereits an anderer Stelle gesagt: In einer Stadt wie Seelow waren die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit allgemein bekannt. Nicht auszudenken, wenn diese Leute plötzlich in VP-Uniform Streife gelaufen wären! Für das ohnehin stark lädierte Ansehen der VP in der Öffentlichkeit, hätte diese Personalentscheidung den Todesstoß bedeutet. Und dennoch blieb ein unangenehmer Geschmack zurück. Hatte N. nicht noch im September vom „Schulterschluss mit den Genossen der Staatssicherheit“ gefaselt?
Als der Befehl zur Auflösung der Kreisämter auch in Seelow publik wurde, begann mit einmal der Schornstein vom Heizhaus der hiesigen Dienststelle heftig zu qualmen.
Argwöhnisch beobachteten etliche Einwohner der Kreisstadt, zunächst noch vor dem Zaun, das seltsame Treiben.
In der Führung des Kreisamtes herrschte dagegen anscheinend die Auffassung, dass Angriff die beste Verteidigung sei. Kurzerhand eilten zwei Abgesandte der sich in Auflösung befindlichen Dienststelle in die Seelower Lokalredaktion des „Neuen Tag“. Dort berichteten sie dem diensthabenden Redakteur, dass die ungewöhnlich starke Rauchentwicklung nichts mit etwaiger Aktenvernichtung zu tun hätte. Vielmehr würden aus dem Dienst ausscheidende Mitarbeiter lediglich ihre künftig nicht mehr benötigten, dennoch jedoch vertraulichen Schulungsmaterialien vernichten. Das kann man glauben, muss man aber nicht. Jedenfalls erschien das Statement des Kreisamtes am nächsten Tag wirklich in der Zeitung.
Anders als erhofft, glaubte die stündlich anwachsende Menge vor dem Objekt den Beteuerungen nicht. Als ein paar besonders Mutige die Stürmung des Kreisamtes forderten, rief ein besonnener Mitstreiter den Leiter der Seelower Kriminalpolizei an. Dieser zögerte nicht lange, holte sich den Kreisstaatsanwalt zur Hilfe, um diesen zum Kreisamt zu eilen.
Durch die Anwesenheit der Staatsmacht bekam der Bürgerprotest so etwas wie einen offiziellen Anstrich.
In Seelow passierte dasselbe wie überall: die Stasi kapitulierte endgültig. Zunächst betrat eine Abordnung das Kreisamt und besichtigte die Räumlichkeiten. Dienst im herkömmlichen Sinn verrichtete dort seit Tagen niemand mehr. Auf die weitere Prozedur, inklusive Bewachung, Räumung und Übernahme der Bewaffnung durch die VP, möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen.
Eine Szene, die mir ein dabei gewesener Kollege Jahre später schilderte, ist es jedoch wert der Nachwelt überliefert zu werden:
Die Mitarbeiter des Kreisamtes mussten bei der Räumung ihrer Dienststelle tatkräftig mitwirken. Unmittelbar vor der endgültigen Versiegelung des Hauses, am letzten Tag des Geschehens, fanden sich alle noch einmal im Speisesaal ein. Unter den Augen von Vertretern der Bürgerbewegung erhielt jeder einzelne seine Entlassungsurkunde.
Zuletzt legten die nun mehr ehemaligen Mitarbeiter ihre „Klappfixe“ in einen Karton, um anschließend in einer Reihe das Haus für immer zu verlassen.
Zufällig hatte ich an diesem Tag, nach meiner Erinnerung handelte es sich um einen Samstag, in Lietzen zu tun.
Der Rückweg führte am aufgelösten Kreisamt vorbei. Dabei begegnete ich dem ehemaligen Cheffahrer, einem noch sehr jungen Oberfeldwebel. Den Blick starr auf den Boden gerichtet, schlurfte dieser, wie ein geprügelter Hund. die Straße entlang. Im Vorbeifahren hob ich die Hand zum Gruß, vermied dabei jedoch jeglichen Blickkontakt. Warum? Weil ich mich in meiner grünen Volkspolizeiunform vor diesem schnöde davon gejagten, seit kurzem ehemaligen Stasimitarbeiter schämte. In diesem Moment kam ich mir ein wenig wie ein Verräter vor.
Mit dem Wissen von heute, im Abstand vieler Jahre, stellt sich für mich die damalige Situation völlig anders dar. Es gab nun einmal keine Alternative zur Auflösung der Staatssicherheit. Und es gab keine Alternative zur Mitwirkung der Volkspolizei bei diesem schwierigen, teilweise verwirrenden Prozess.
Das aufgelöste „Kreisamt für Nationale Sicherheit“ war bei weitem nicht das einzige „Geheimobjekt“ auf dem Territorium des Kreises Seelow.
In den Wäldern in der Nähe Treplins, am Ufer des Bärenfangsees, unterhielt die Staatssicherheit ein großes Ausbildungs- und Schulungsobjekt. Unweit davon, an der Kreisgrenze in Richtung Frankfurt (Oder), ließ ein über die Baumkronen ragender Funkmast eine Abhöranlage vermuten. Ein weiteres Trainingscamp der Staatssicherheit befand sich außerdem in der Nähe von Lebus.
Zu meinem großen Erstaunen residierte selbst in meinem Wohnort Manschnow die Staatssicherheit.
In der Friedensstraße, gegenüber dem Sportplatz, betrieben die „Tschekisten“ eine Tischlerei, welche aus einem Wohnhaus, einem Heizhaus und einer mit grünem Blech verkleideten Werkhalle bestand.
Der Mitarbeiterstamm setzte sich aus einem als Leiter fungierenden Leutnant und einem Zivilangestellten zusammen. Die besagte „Stasitischlerei“ befand sich nur wenige hundert Meter von meiner Wohnung entfernt.
Nach wenigen Minuten Fußmarsch, durch das von feuchtkalten Nebelschwaden überlagerten Oderbruch, traf ich am Einsatzort ein. Das Objekt lag völlig im Dunkeln, lediglich aus dem direkt an der Straße gelegenen Hauptgebäude schimmerte mattes Licht. Etwas unschlüssig stand ich zunächst vor dem verschlossenen Tor, bis ich die Klingel entdeckte. Nachdem ich diese betätigt hatte, schlurfte Hauptmann Walter K. heran. Leise hüstelnd, öffnete er mir die Eingangstür. Beim Betreten des Geländes fielen mir die vielen, mehr oder weniger großen Steine auf, welche hinter dem Tor lagen.
Walter K. winkte ab und sagte: „Hier haben sich heute am Tag empörte Manschnower versammelt und Steine über das Tor geworfen. Ich habe mich dann gezeigt und gesagt, dass das Objekt von der VP bewacht wird. Als sich das dann herumgesprochen hatte, war sofort Ruhe.“
Bei dem Gedanken, möglicherweise in der Nacht von empörten Bürgern belagert zu werden, wurde mir dann doch etwas blümerant zumute.
Hauptmann K. öffnete die Tür des Hauptgebäudes das von außen wie ein ganz normales Wohnhaus erschien. Durch eine Veranda ging es über den Flur ins „Wohnzimmer“, dass den Tischlern als Pausenraum diente.
Dieses Zimmer bestand aus einigen Schränken, Tisch und Stühlen, einer Liege und, ganz
wichtig für mich, einem Fernsehgerät. Übrigens schwarz-weiß, aus DDR-Produktion. Überhaupt suchte man Luxus in diesem Hause vergeblich! Wenigstens war ein Telefon vorhanden. Nicht ganz unwichtig, wenn man völlig auf sich allein gestellt, in solch einem brisanten Gebäude Wache hielt.
Kurz darauf klingelte es erneut an der Tür. Hauptmann B. wollte noch einmal nach dem Rechten sehen. Im Fernsehgerät lief gerade die „Aktuelle Kamera“.
Wie an jedem Montag, zogen viele tausend Demonstranten durch die Leipziger Innenstadt. Gebannt schauten wir auf den Bildschirm. Der Grundtenor der Leipziger Montagsdemonstration befand sich im hörbaren Wandel. Unter die Rufe nach einer besseren DDR mischten sich mehr und mehr die Forderungen nach einem „Deutschland einig Vaterland“.
Hauptmann Walter Walter K. kommentierte das Gesehene folgendermaßen:
„Das ist so, als wenn der Oderdamm bricht, dabei wird auch vieles hinweg gespült, was eigentlich gut und erhaltenswert ist. Noch sind wir zweistaatlich. Lange wird dieser Zustand wohl nicht mehr anhalten.“
Manfred B. pflichtete ihm bei. Ich staunte immer wieder, wie pragmatisch gerade einige der älteren Polizisten mit der sich täglich ändernden Situation umgingen. Mir fiel es jedenfalls unheimlich schwer, diese Flut von Eindrücken emotional einzuordnen. Was heute noch Weiß ist, kann schon morgen pechschwarz sein, wer heute noch dein Freund ist, kann schon morgen dein Feind sein. Verstehe einer noch diese Welt!
B. zündete sich eine Zigarette an. Dann wies er mich in meine Aufgaben ein. Kein Unbefugter durfte das Objekt betreten! Das traf auch auf den Hauptamtlichen „Stasi-Tischler“, einem Leutnant, zu. Lediglich seinem Kollegen, einem Zivilangestellten, hatte das Bürgerkomitee eine Gnadenfrist eingeräumt. In den kommenden Tagen durfte er die Werkstatt aufräumen und seine persönlichen Dinge abholen.
„Allerdings würde der Zivilangestellte wohl kaum in der Nacht erscheinen“, meinte B. grinsend. Walter K. zeigte mir dann noch das Heizhaus.
„Wenn dir kalt wird, dann kannst du noch eine Schippe nachlegen. Aber übertreibe es nicht!“, sagte er und wies dabei auf den eisernen Ofen.
Gegen 20:00 Uhr verließen die beiden Hauptleute das Gelände der Tischlerei. Zuvor hatte Walter Walter K. dem „ODH“ die Wachübergabe gemeldet.
Endlich allein, begann ich zunächst, das mir anvertraute Areal zu inspizieren. Zunächst nahm ich von außen die verschlossene Tischlereiwerkstatt in Augenschein.
Glaubte man den kursierenden Gerüchten, dann verbargen sich hinter dem grünen Blech hochmoderne Maschinen und Werkzeuge aus westlicher Produktion. Neugierig presste ich mein Gesicht gegen eine der Fensterscheiben. Zu sehen gab es in der dunklen Werkstatt jedoch nichts.
Fröstelnd, inzwischen wehte böiger Ostwind von der Oder her übers Land, zog ich mich in das Innere des Hauses zurück.
Immer noch neugierig, streifte ich durch die Gänge und Zimmer. Nichts deutete daraufhin, dass es sich bei dem so harmlos ausschauenden Haus um ein „Stasi-Objekt“ handeln würde. Endlich entdeckte in einem ansonsten ausgeräumten Umkleideschrank, ein hölzernes Wappen des MfS, Schild und Schwert darstellend.
Ein wenig enttäuscht, setzte ich mich vor dem Fernseher. „AK Zwo“, die neue Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens, berichtete über die Ereignisse des Tages.
Inzwischen kühlten die Räume immer mehr aus. Um mir keine Lungenentzündung einzufangen, eilte ich kurzentschlossen hinüber ins Heizhaus.
Den Rat von Hauptmann Walter K., „es nicht zu übertreiben“, ignorierend, beförderte ich mehrere Schippen Kohle in den eisernen Ofen. Bereits wenige Minuten später breitete sich wohlige Wärme in meiner „Wachstube“ aus.
Als selbst der mitgebrachte Kaffee nicht mehr gegen die aufkommende Müdigkeit helfen wollte, drehte ich eine Runde auf dem Hof
Frische Luft ist noch immer die beste Medizin gegen lähmende Schläfrigkeit! Träge trabte ich auf dem Areal umher.
Versonnen schaute ich den dicken schwarzen Rauchwolken nach, welche vom Schornstein des Heizhauses in den von funkelnden Sternen übersäten Nachthimmel stiegen. Dunkler schwarzer Rauch? Mir fiel es wie Schuppen von den Augen! Schlagartig wurde mir bewusst, was Hauptmann Walter K. wohl gemeint haben könnte.
Auch wenn es nicht so aussah: ich befand mich in einem Stasi-Objekt. Momentan reagierte die Bevölkerung absolut allergisch, wenn dicker schwarzer Rauch aus eben einem solchen Objekt aufsteigt. Trotz des kühlen Wetters, stand mir sofort der Schweiß auf der Stirn. Vor meinem geistigen Auge sah ich bereits empörte, Aktenvernichtung witternde Bürgerrechtler vor dem Tor stehen. Wie hätte ich ihnen erklären sollen, dass mir ganz einfach nur kalt war?
Gott sei Dank schlief die Revolution in dieser Nacht. Zumindest in Manschnow. Niemand hatte die Rauchwolken bemerkt. Hundemüde, aber endlos erleichtert, übergab ich die Tischlerei an meine Ablösung.
Schon vierundzwanzig Stunden später stand ich wieder auf der Matte. Diesmal leistete mir der Zivilangestellte, ein freundlicher Mittvierziger, Typ „Papa“, mit leichtem Bauchansatz und Stirnglatze, Gesellschaft. Leutselig schüttelte er mir die Hand zur Begrüßung.
„Darf ich mal das Telefon benutzen?“, fragte der Tischler und wies mit dem Zeigefinger auf den grauen Fernsprechapparat.
„Ich will nur mal kurz in der Dienststelle Bescheid sagen, dass ich hier bin“, fügte er erklärend hinzu. Selbstverständlich hatte ich nichts dagegen. „Guten Morgen, Klaus hier. Bin wieder in Manschnow, um noch ein wenig aufzuräumen.“
Ich stand nahe genug vor dem Telefon, um die Antwort der „Gegenstelle“, welche sich in dem seit mehreren Tagen besetzten „Bezirksamt für Nationale Sicherheit“ in Frankfurt (Oder) befand, mit anzuhören:
„Ja, ist in Ordnung. Sind die Bullen noch da? Bei uns hier ist alles voll mit dem Grünzeug.“
Der Fragesteller hatte tatsächlich Bullen und Grünzeug gesagt. In einem unsäglich verächtlichen Tonfall. Besser konnte man wohl nicht ausdrücken, was die meisten Stasimitarbeiter vom einstigen „Bruderorgan“ hielten.
Bei einer Tasse Kaffee erfuhr ich anschließend aus seinem Mund die von den offiziellen Berichterstattungen in einigen Nuancen abweichende Version von den Geschehnissen der letzten Tage rund um die „geheime Tischlerei“. Laut dem Zivilangestellten war seit langem allgemein bekannt, dass die Tischlerei vom MfS betrieben wurde. Bis zur „Wende“ hatte sich allerdings niemand daran gestört. Im Gegenteil! Jahrelang hatten sich Tischler aus der Umgebung Werkzeuge ausgeborgt. Enttäuscht schilderte mein Gesprächspartner, dass sich unter den Demonstranten etliche von den bereits erwähnten Tischlern befanden. Er vermutete, dass sich einige von ihnen die Maschinen zum Aufbau eines eigenen Unternehmens unter den Nagel reißen wollten. Vehement räumte er mit dem Vorwurf auf, dass die Tischlerei über „hochmoderne Technik aus westlicher Produktion“ verfügte. Wozu auch? Wurden doch in Manschnow lediglich kaputte Büromöbel repariert oder unbedeutender „Nippes“ angefertigt. Anspruchsvolle Aufträge, zum Beispiel ein überdimensionales, als Geburtstagsgeschenk für Erich Mielke gedachtes Bierfass, wurden grundsätzlich von „zivilen“ Tischlereibetrieben ausgeführt. In erster Linie von einem traditionellen Privatunternehmen aus der Nähe von Seelow. „Die haben sich eine goldene Nase verdient“, meinte der „Stasi-Tischler“ bitter. „Komischerweise haben sie sich nicht daran gestört, dass die Aufträge von der Stasi kamen.“
I
m Verlauf des Gesprächs erfuhr ich von dem Tischler, wie in einigen Betrieben auf die „neuen Kollegen aus den Reihen der aufzulösenden Staatssicherheit“ umgegangen wurde:
„Ich kenne da einen früheren Unterleutnant. Der hat bis Ende November als Busfahrer in der Bezirksverwaltung gearbeitet und Anfang Dezember im Kraftverkehr angefangen. Keiner von den dortigen Kollegen wollte auch nur ein Wort mit ihm reden. Beim Mittagessen hat man ihm ins Essen gespuckt.“
Beispiele wie diese jagten mir eisige Schauer den Rücken herunter. Gegen die Stasi zu sein, gehörte mittlerweile zum „guten Ton“.
Bezeichnenderweise taten sich dabei vor allem jene hervor, in deren bisherigen Leben es kaum zu Berührungen mit der Staatssicherheit gekommen war.
Zu einer anderen Kategorie gehörte der Typus von staatlichen Leitern, welche in aller Eile Schilder mit der Aufschrift „Wir stellen keine ehemaligen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ein“ vor den Eingängen der Betriebe aufstellten. Konnten sie doch darauf hoffen, dass dieser offenkundige Aktionismus so manche staatskonforme Handlung aus der Vergangenheit in einem milderen Licht erscheinen ließ.
„Warte ab, ihr kommt auch noch dran“, prophezeite mir der Tischler bitter. „Noch brauchen sie euch. Aber irgendwann sind sie mit uns fertig.“
Ich konnte ihm nicht widersprechen. Warum sollte die „Abrechnung“ ausgerechnet um die Volkspolizei einen Bogen schlagen?
Gegen 16:00 Uhr verabschiedeten wir uns. Der Tischler schaute noch einmal wehmütig auf seinen einstigen Arbeitsplatz zurück. Dann stieg er in seinen vor dem Gelände stehenden Trabant und fuhr davon. Ich habe ihn nie wiedergesehen.




